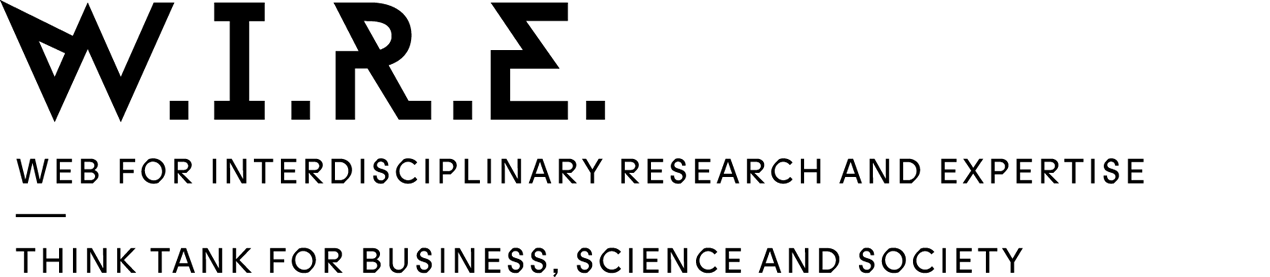Die inszenierte Andersartigkeit: Der FC St. Pauli ist der Freibeuter im deutschen Klubfussball. Von Florian Huber
Kaum ein Sportverein hat das Image des Underdogs so erfolgreich kultiviert wie der FC St. Pauli. Auch im 100. Jahr hisst er die Piratenflagge gegen das Establishment und die Kommerzialisierung der wichtigsten Nebensache der Welt.
Es ist ja nicht mehr wie früher, als man die Piraten in Hamburg zur Hölle wünschte. Im Gegenteil, im Museum für Geschichte wünscht man sich seit neuestem schmerzlich eine Hauptattraktion zurück: den Schädel des berüchtigten Störtebekers – er wurde geklaut. Auch die Hafenstrasse ist heute kein Brennpunkt gesellschaftlicher Kämpfe mehr, wo die Staatsgewalt auf den militanten Widerstand einer autonomen Gegenkultur stösst, sondern eine normale Wohngegend. Aber wenn im Millerntor-Stadion zu den Klängen von «Hells Bells» die Fussballer einlaufen, ist sie trotzdem omnipräsent: Die Piratenflagge mit den gekreuzten Knochen und dem Totenschädel. Sie ist längst das inoffizielle Emblem des FC St. Pauli geworden. Und auch wenn das Team nicht mehr wie in den 70er-Jahren ein Haufen von Amateuren ist, die den klapprigen VW-Bus eigenhändig durchs Land steuern, um die etablierten Klubs mit ihren gelackten Profis herauszufordern – das Selbstverständnis als Freibeuter des deutschen Klubfussballs bleibt. Und es ist mehr als nur Koketterie mit der Geschichte der freien Hansestadt. Der FC St. Pauli ist beides, Wahrer von Werten und Traditionen und Schrittmacher im Umfeld der wichtigsten Nebensache der Welt. Dieser Mischung verdankt er nicht nur sein Selbstbewusstsein, sie ist ein zukunftsweisendes Modell.
ALLEGORIE DER ANDERSARTIGKEIT
Wie die Verkörperung der Vereins-Philosophie des «non-established since 1910» wirkt sein Präsident. Corny Littmann ist weder Baulöwe noch Grossunternehmer, und auch kein abgehalfterter Ex-Fussballer, dafür ein streitbarer Kämpfer – und eine ehrliche Haut. Bekanntheit erlangte er in Deutschland in den 90er-Jahren als Kabarettist. Als bekennender Homosexueller polarisierte er als Politiker. Für die Grünen hatte er einst für den Bundestag kandidiert und schon dabei den Skandal gezielt für den Wahlkampf genutzt. Mittlerweile ist aus dem Aktivisten Littmann ein mittelständischer Unternehmer geworden. Auf der Reeperbahn führt der Endfünfziger seit über 20 Jahren erfolgreich zwei private Theaterhäuser, «Schmidts Theater» und «Schmidts Tivoli», und bemüht sich so um seine Liebe zur Bühne und eigenhändig um die Aufwertung eines Stadtteils, der trotz verklärter Aura doch zu den problematischen Hamburgs gehört – eine Langstrasse im Grossformat. Diese Erfahrungen und sein Hintergrund als Minoritäten-Vertreter und St-Paulianer machten ihn 2002, als der FC sportlich auf Talfahrt und finanziell mit Millionen Euro Schulden am Abgrund war, zum Wunschkandidaten für das Präsidentenamt. Und der Theatermann führte den Verein mit einer pragmatischen Mischung aus Geschäftssinn und Flair für das Image zurück in eine sichere wirtschaftliche und sportliche Existenz.
DER MYTHOS IM ZEITALTER DES MARKTES
Geboren wurde der Mythos St. Pauli aus den Resten der Protestbewegung, die 1968 mit Spontan-Aktionen Deutschland aufrüttelte und sich danach militant gegen die bürgerliche Gesellschaft abschottete. In der linken Subkultur Hamburgs hielt man das Andenken an die Seeräuberei, vor allem die lokalen «Likedeeler» immer hoch. In der besetzten Hafenstrasse unweit des Millerntors besangen «Slime», Wortführer des Deutsch-Punk, im gleichnamigen Lokal den Piraten Störtebeker als Robin Hood. Irgendwann in den 80ern entdeckten die Bewegten ihre Liebe zum FC St. Pauli, dem chancenlosen Proletarierklub, dem sie fortan in Abgrenzung zum bürgerlichen Lokalrivalen HSV huldigten – je erfolgloser das Team, desto hingebungsvoller. Mit ihnen kam die Piratenflagge ins Millerntor-Stadion, und jenes Publikum, das sich als autonom und progressiv verstand und mit Sprechchören, Transparenten und Spass-Guerilla-Aktionen Stimmung machte, auch gegen Rassismus und Diskriminierung, Kommerz und Sport-industrie. Es entstand der Kult um den «sexy Aussenseiter», der in den 90er-Jahren zusammen mit der «Hamburger Schule» um Bands wie Blumfeld und deutschem Hip Hop zum popkulturellen Exportschlager wurde. Doch viel änderte sich nach den «roaring 90ies», als St. Pauli mit vier Jahren 1. Bundesliga seine Hochblüte erlebte. Fussball und Industrie gingen neue Partnerschaften ein, Kommerzialisierung und Event-Kultur verschafften den Vorreitern der Entwicklung finanzielle Möglichkeiten, mit denen man nicht mithielt. Zur Verschuldung kam sportlicher Abstieg, 2003 fand man sich in der Regionalliga wieder. Mit der Loyalität der Fans war es nicht mehr getan, auch nicht mit ihrer Kultur, einst avantgardistisch, mittlerweile aber in fast jedem europäischen Stadion imitiert. Nun hatte die Stunde geschlagen für einen Freibeuter neuer Art, einen vom Schlage Littmanns.
KAPERFAHRT GEGEN VEREINNAHMUNG
Littmann hatte seit Urzeiten ein Herz für die Kiezkicker und deren Verwurzelung im Viertel und der linken Intelligenzija. Aber er weiss auch, wie in einem freien Unterhaltungsmarkt mit knappen Mitteln gearbeitet werden muss, um Erfolg zu haben. Er begann, den FC St. Pauli gegen alle Widerstände zu erneuern. Aber die Scheuklappen gegenüber Modernisierungen und die linke Romantisiererei wurden abgelegt. Im neuen Millerntor-Stadion gibt es heute die gleichen Mantelnutzungen wie überall: Vip-Lounges, Kongresszentrum, Shops. Über seine Mitglieder, die via Jahresversammlung ihren Einfluss behalten, kontrolliert der FC St. Pauli die von Tochterfirmen betreute Wertschöpfungskette vom Bierausschank bis zu den Sponsoringrechten. Selbst der Verkauf der Namensrechte am Stadion wurde verboten. Diese Strategie bannt nicht nur die Gefahr, von geschäftlichen Interessen einzelner Inves-toren vereinnahmt und der kommerziellen Ausschlachtung preisgegeben zu werden. Sie minimiert auch das Klumpenrisiko, das manchen Traditionsklub, der Aktiengesellschaft wurde, zum gestrauchelten Oligarchen machte. Der FC St. Pauli ist ein strukturiertes Spitzensport-Unternehmen. Aber seine Politik wahrt ihm die Hoheit über die propagierten Werte, seine Identität und sichert ihm eine nachhaltige ökonomische Basis mit dem Fussball als Kerngeschäft. Das ist zukunftsträchtig. Bei einem Grossteil der Konkurrenz hängt die sportliche Existenz am Auf und Ab der Finanzund Weltwirtschaft. Wenn im August offiziell die 100. Saison des Vereins beginnt, könnte sogar das erklärte Ziel erreicht sein, der Aufstieg in die 1. Bundesliga. Und endlich wieder, unter wehender Piratenflagge, kann die ureigene Mission verfolgt werden: das Establishment ärgern.
Florian Huber war auch schon hoffnungsvoller Fussballer und Kulturveranstalter. Heute studiert er Geschichte, Sprachund Politikwissenschaft an der Universität Zürich und arbeitet als freier Journalist, vor allem im Bereich Sport.