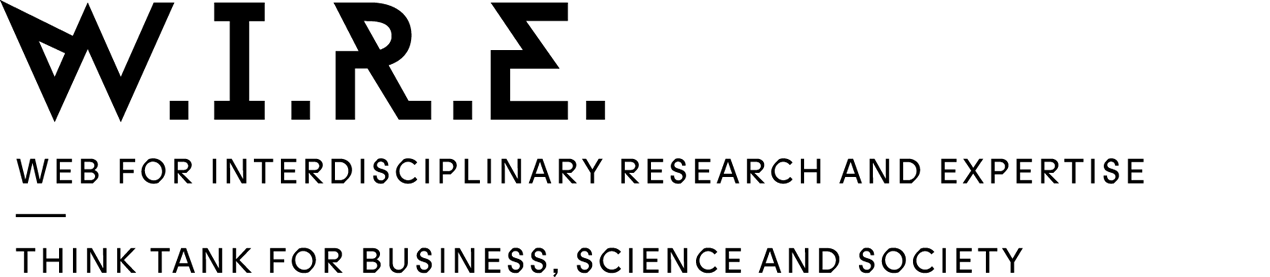Nach der Party. Essay von Peter Firth
Der wertvollste Rohstoff des 21. Jahrhunderts könnte die Information sein, wie alt Sie sind, wann Sie heirateten, wie oft Sie einkaufen und vor allem wo. Für Unternehmen ist es entscheidend geworden, persönliche Daten zu besitzen. Würden diese plötzlich knapp, krempelte das die Machtverhältnisse der Wirtschaft radikal um.
Anekdoten über die mythische Vorhersagekraft von Big Data hört man heutzutage allerorten. Unternehmen gelingt es mittlerweile, aus den grossen Datensätzen Profit zu schlagen. Vormals unbewältigbare Statistiken sind verwertbar geworden. In den letzten Jahren war so etwa zu lesen, dass Big Data Grippeepidemien vorhersagen könne, bevor sie ausbrächen, dass man eine Schwangerschaft indizieren könne, bevor die Betroffene es selber weiss, und dass dasselbe angeblich auch für den Zeitpunkt unseres Todes gelte. Während solche Entwicklungen Anbieter von Konsumprodukten vor Glück erzittern lassen, bereiten sie Konsumenten Sorgen. Denn die Beziehung zwischen Individuum und Unternehmen hat sich geändert: Wir sind zwar immer noch Konsumenten, aber dank Big Data sind wir auch das Produkt und der Rohstoff dafür.
Das Phänomen der Massendatenauswertung (Big Data) basiert auf Datenmassen. Es funktioniert nach dem Prinzip, dass man die Absichten des Konsumenten umso besser vorhersagen kann, je mehr Daten man über ihn sammelt. Und umso mehr kann man ihm anschliessend verkaufen.
VOM ÜBERFLUSS ZUR KNAPPHEIT
Nun gibt es allerdings Entwicklungen, die darauf hindeuten, dass uns eine Zeit bevorsteht, in der Kundeninformationen für Unternehmen nicht mehr derart frei verfügbar sind, und in welcher Konsumenten den Gegenwert ihrer persönlichen Daten einfordern. Kurz gesagt: Persönliche Daten könnten knapp werden.
Es gibt verschiedene Arten, wie Menschen ihr Online-Verhalten ändern können, um Unternehmen Daten zu entziehen. Die erste und offensichtlichste ist es, weniger persönliche Daten zu teilen und sich aus Services zurückzuziehen, die Informationen über Verhaltensweisen und Bewegungsmuster speichern. Die zweite ist die Nutzung neuer Services und Plattformen, die unsere Spuren im Netz verschleiern.
In den letzten Jahren haben sich zwischen Nutzern und Organisationen im Webbereich zunehmend subtile Austauschbeziehungen entwickelt, in denen Unternehmen aus der Web- und IT-Branche fast unmerklich begonnen haben, mit uns um den Zugang zu unseren persönlichen Informationen zu feilschen. Wir geben diese Informationen im Gegenzug für einmalige Preiserlässe her, für den Zugang zu sozialen Netzwerken oder um Werbungen zu umgehen. Doch mit der zunehmenden Erkenntnis, welche Auswirkungen diese Tauschbeziehungen haben – dass nämlich die Menge persönlicher Informationen, die ein Unternehmen besitzt, quasi gleichbedeutend geworden ist mit dessen Profitabilität –, beginnen User das Ausmass dessen, was sie preisgeben, zu reduzieren. Denn vom persönlichen Verlust an Privatsphäre scheinen Unternehmen mehr zu profitieren als sie selber.
Wie schnell dieser individuelle Bewusstseinswandel stattfindet, belegen Studien, die der Londoner Think Tank The Future Laboratory – dem ich angehöre – in den letzten Jahren durchgeführt hat. Noch im Oktober 2012 waren von 2000 befragten Einwohnern Grossbritanniens nur 22 Prozent nicht bereit, ihre persönlichen Daten im Gegenzug für Dienstleistungen (wie den Zugang zu sozialen Netzwerken) bereitzustellen, 16 Prozent wollten dies nicht einmal gegen Geld. Nur ein halbes Jahr später, im März 2013, war dieser Unwille auf 39 respektive 27 Prozent gestiegen. Ein weiterer Beleg für die latente Panik der Konsumenten um ihre persönlichen Daten ist die in England Anfang 2013 erfolgte Etablierung eines Fair-Data-Labels für Unternehmen, die versprechen, verantwortungsvoller mit Daten umzugehen als die Konkurrenz.
UNSER LEBEN IN DATEN
Der Besitz von persönlichen Datenbeständen wird mittlerweile weithin als wichtiger Vermögensbestandteil eines Unternehmens betrachtet. Ihr Besitz ist keine Randerscheinung mehr. Die Unternehmen haben schnell gelernt, dass es vor allem darum geht, über Daten zu verfügen, zu denen die Konkurrenz keinen Zugang hat. Genau wie bei jedem anderen Gut gilt: je rarer, desto wertvoller. Für uns als Konsumenten bedeutet dies, dass unsere persönlichen Daten – über die ja nur wir selber verfügen – dabei sind, eine Form privaten geistigen Eigentums zu werden. Etwas, das andere wollen, und das man zurückhalten kann. Auf einmal schei
nen unsere persönlichen Details, unsere Verhaltensweisen, einen konkreten Marktwert zu bekommen. David Siegel, Autor von «Pull: The Power of the Semantic Web to Transform Your Business», sieht darin eine bemerkenswerte Machtverschiebung zugunsten des Konsumenten: «Die Kontrolle über die persönlichen Daten wird aus den passiven Konsumenten von heute in Zukunft aktive Marktteilnehmer machen, die über mehr Macht verfügen als die grössten multinationalen Unternehmen.»
Aufgrund dieses neuen Bewusstseins verknappen wir im Netz unsere Daten immer mehr. Durch die simple Entscheidung beispielsweise, unser Arbeitsleben auf der Plattform LinkedIn zu verwalten und unser Privatleben auf Facebook zu pflegen, teilen wir unsere Web-Identitäten auf – und enthalten so den einzelnen Unternehmen, die diese Websites betreiben, persönliche Daten vor. Und auch innerhalb dieser Plattformen wiederum begrenzen wir, was wir wem zeigen: ob Arbeitgebern, Freunden oder Unternehmen, die solche Profile auswerten.
Sogar das Internet als Hort des Datenaustauschs wird mittlerweile umgangen: Eine Menge Traffic läuft heutzutage über das im Internet durch Datenumleitungsverfahren versteckte «Deep Web». Und mit der Errichtung alternativer Datennetzwerke wie etwa den sogenannten Meshnets aus miteinander verknüpften, privaten Heimcomputern, beginnen Nutzer ihre persönlichen Daten sogar physisch auf verschiedene Orte aufzuteilen.
Ein weiterer Grund für den vorsichtigeren Umgang mit dem Web ist die mittlerweile allgemein bewusst gewordene «Unsterblichkeit» der Daten. Nachrichten, Posts, Likes und Mails werden allesamt von Systemen gespeichert, die keineswegs den individuellen Verfassern selber gehören. Um einen Eindruck davon zu bekommen, wie frisch auch längst Vergangenes im Netz erscheint, besuchen Sie doch einmal die Website des Warner-Bros.-Films «Space Jam» von 1996.
Mittlerweile haben Softwareentwickler auf die Nachfrage nach Vergänglichkeit reagiert. Auf Plattformen wie Snap Chat werden Nachrichten gelöscht, sobald sie gelesen wurden. Justdeleteme.com ermöglicht das gezielte Löschen persönlicher Daten und Accounts, vom Versandhaus Amazon bis zum Zimmersuchservice Airbnb. Mit einem Klick ist alles weg.
Es gibt übrigens auch geopolitische Treiber für eine künftige Datenknappheit. Die sogenannte Balkanisierung, also die Aufsplittung des Internets in verschiedene geografische Räume, schränkt Datenflüsse zwischen Regionen zusehends ein. Prominentestes Beispiel dafür ist Chinas Projekt Goldener Schild, das als eine Art grosse Zollbehörde für das Datenuniversum fungiert.
MÄCHTIGE DATENKARTELLE ODER BÜRGER
Die Datenknappheit würde eine Welle neuer wirtschaftlicher Verhaltensweisen und Machtverschiebungen mit sich bringen. Diese Veränderungen würden sich zwischen zwei möglichen Extremen abspielen. Im einen Extrem würden Unternehmen einem geschlossenen Modell folgen, um ihre Datenbestände noch stärker zu verwerten und Daten mit einem exklusiven Kreis alliierter Unternehmen zu tauschen. Das andere Extrem wäre die Entstehung von Marktplätzen für persönliche Daten, in denen Individuen ihre Daten auktionieren könnten.
«Wenn wir uns vorstellen, dass Datenbestände neben der Kompetenz der Mitarbeiter und dem Vermögensbestand zu den wichtigsten Geschäftsgrundlagen werden», sagt Kenneth Cukier, der leitende Datenjournalist des Wirtschaftsmagazins «The Economist», «dann wäre in einem Zeitalter der Datenknappheit davon auszugehen, dass sich abhängige, kleinere Unternehmen rund um grössere mit bestehenden Dateninfrastrukturen zusammenschliessen würden, ähnlich wie einst die Keiretsus in Japan.»
In Japan gelang es Unternehmen im Anschluss an die Wirtschaftskrise von 2008, die Effekte der Rezession, also der Knappheit an Geld, zu umgehen, indem sie sich auf traditionelle Wirtschaftsnetzwerke, sogenannte Keiretsus, zurückbesannen. Jedes grössere Keiretsu ist mit einer Bank verbunden, die abhängige Unternehmen kontrolliert, indem sie als Überwacher agiert, aber dafür im Krisenfall auch Kapital einschiesst. Keiretsus beruhen auf Ausschluss und Hierarchie. Der Handel mit rivalisierenden Keiretsus ist verboten. In Krisenzeiten kann dafür vom Handelshaus an der Spitze Geld geliehen werden. So wird in Zeiten der Geldknappheit die Ordnung gewahrt.
Mit der zunehmenden Entwicklung des Datenzeitalters könnte dieses Modell zum Umgang mit Knappheit auch auf Datenknappheit angewandt werden. Wenn die Notwendigkeit, Datenbestände aktiv zu bewirtschaften, zunehmen würde, könnten sich Informationskartelle formieren, die nur innerhalb ihres Keiretsu ihr Kapital an Daten teilen. Allerdings würden sich diese Kartelle nicht um Sony oder Mitsubishi herum zusammenschliessen, sondern um Firmen, die den besten Zugang zu Daten und Verwertungsmethoden haben – Unternehmen mit gigantischen Datenbeständen wie Google, Amazon oder Facebook.
Grosse Einzelhändler setzen bereits auf Partnerschaften mit solchen Informations-Kraftwerken. Der britische Konzern Arcadia schätzt beispielsweise, dass der grösste Teil des Gewinnzuwachses seiner Tochterfirma, des Textilanbieters Topshop – immerhin 39,1 Millionen Euro – auf dessen Facebook-Präsenz mit 750 000 Fans beruht.
Auch wenn diese Entwicklungen den Grundprinzipien des Web 2.0 mit seinen Ansätzen zu Open Source, freier Zusammenarbeit und Wissensteilung vollkommen widersprechen, eröffnen sie auch Chancen für das Individuum. Die Datenknappheit könnte elektronische Marktplätze hevorbringen, auf denen Einzelne die Möglichkeit erhalten, ihre Datenbestände zu verkaufen oder gegen Produkte, Dienstleistungen und andere Informationen einzutauschen. Im Unterschied zu heute würden Tauschbeziehungen explizit sichtbar. Die Menschen würden die vollständige Kontrolle darüber erlangen, welche Unternehmen gerade für wie lange Zugang zu welchen Daten erhalten. Big-Data-Handelshäuser könnten entstehen, die sich um unsere spezifischen Datenbestände kümmern, und diese erst dann verkaufen, wenn ihr jeweiliger Marktwert am höchsten ist. Ähnlich wie es einst Web-2.0-Vordenker Doc Searls, der Mitverfasser von «Das Cluetrain Manifest», in seinem Modell der «Intention Economy» 2006 formulierte, werden Individuen die Möglichkeit erhalten, ihre Daten einer hungrigen Meute von Unternehmen anzubieten – und sie jenem geben, der das beste Gebot abgibt.
Dieser neue, mit der Kraft seiner Daten gestärkte Konsument könnte sein neu erstandenes, quasi-intellektuelles Eigentum dazu verwenden, bessere Leistungen und Produkte zu erhalten. Das würde aus den persönlichen Daten irgendwie auch eine Form der Netzwerk-Währung
machen – erschreckend und ermächtigend zugleich. Ermächtigend, weil der Einzelne nicht länger einer versteckten Art des Datendiebstahls unterworfen wäre. Erschreckend aber, weil die Anzahl der Möglichkeiten, sich vor der Big-Data-Revolution zu verstecken, wohl noch geringer würde.
Festzuhalten bleibt: Die Knappheit an persönlichen Daten hat das Potenzial, die Regeln des Datenspiels zu ändern. Und je mehr Plattformen entstehen, um den Menschen die Kontrolle zurückzugeben über den Reichtum an empirischen Fakten, den ihr tägliches Leben generiert, desto stärker wird die Macht in den Händen des Konsumenten.
Peter Firth ist Autor und Technologieredakteur für LS:N Global, das Trendbeobachtungs-Netzwerk des Londoner Think Tanks The Future Laboratory. Seit April 2012 ist er auch der Kolumnist für Zukunftsthemen der Technologiepublikation «T3», wo er sich mit den grossen Fragen rund um unsere Beziehung zur Technologie beschäftigt. In jüngster Zeit trat Firth beim BBC World Service und in der «Sunday Times» als Experte für Branding, die Zukunft der menschlichen Kommunikation sowie die Frage in Erscheinung, wie die Unter- Elf-Jährigen Technologie, Medien und Handel beeinflussen.