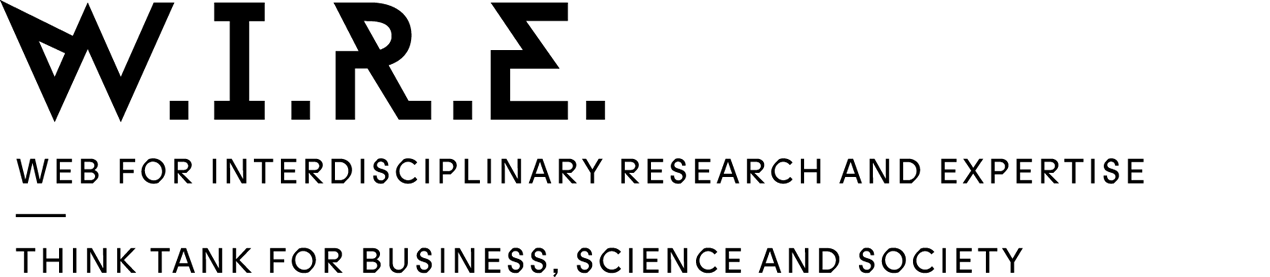Leben und sterben lernen. Von Stephan Sigrist & Hlin Helga Gudlaugsdóttir

Während wir im echten Leben den Tod bis zum allerletzten Moment abwenden wollen, sind wir in der digitalen Welt bereits unsterblich. Beides ist nicht wirklich wünschenswert. Was es braucht, ist eine neue Kultur des Sterbens.
Der Tod ist allgegenwärtig. Allein in der Zeit, die Sie benötigen, diese ersten Zeilen zu lesen, sterben zehn oder mehr Menschen auf der Welt, durchschnittlich zwei Menschen jede Sekunde. Mit dem steigenden Durchschnittsalter der Bevölkerung – bis 2050 werden in vielen Ländern Europas bis zu 40 Prozent der Menschen 60 Jahre oder älter sein – wächst nicht nur der Pflegebedarf, sondern auch die Bedeutung der Betreuung am Lebensende. Als Folge dürfte das Bewusstsein, dass das Leben zwar länger, aber dennoch endlich ist, in den nächsten Jahren zunehmen. Daneben wird auch der Fortschritt der medizinischen Forschung unsere Wahrnehmung des Sterbens verändern: Zum einen setzen sich immer mehr Unternehmen das Ziel, Therapien für altersbedingte Krankheiten zu entwickeln. Neben den traditionellen Pharmaunternehmen arbeitet selbst Google mit dem Start-Up-Unternehmen Calico daran, den Tod zu besiegen, indem es riesige Datenbestände der Alterskrankheitenforschung neu durchleuchtet. Damit steigt die allgemeine Erwartungshaltung, noch älter zu werden. Zum andern wird die immer leistungsfähigere Diagnostik dazu beitragen, dass wir unseren Gesundheitszustand und genetische Veranlagungen besser kennen und darauf basierend möglicherweise schon bald präzise Prognosen über unsere Lebenserwartung erhalten, die eine Auseinandersetzung mit unserem Schicksal unvermeidbar machen.
Jenseits der Endlichkeit
Bislang beschäftigen wir uns in der westlichen Welt aber nur selten mit dem Sterben. Der Fokus unserer Aufmerksamkeit wie auch der des Gesundheitsmarkts liegt auf dem Leben und den Möglichkeiten seiner Verlängerung. Der Tod wird weitgehend marginalisiert und tabuisiert. Kranke, geschweige denn sterbende Menschen, sind nicht Teil des öffentlichen oder privaten Lebens der auf Vitalität getrimmten Gesellschaft. Die Investitionsfelder der modernen Medizin konzentrieren sich auf die Verbesserung der Gesundheit und auf die Schaffung eines noch längeren, aktiveren und genussvolleren Lebens. Für die Auseinandersetzung mit dem Sterben bleibt kein Platz.
Als Folge davon findet die Beschäftigung mit der Endlichkeit nicht in einem öffentlichen Diskurs, sondern in der Fiktion statt: in Filmen oder Büchern konfrontieren wir uns täglich, teilweise schon fast exzessiv, mit dem Sterben. Kein Kriminalfilm kommt ohne Leiche aus, Hollywood produziert Kassenschlager, die das Ende der Menschheit prophezeien. Wir simulieren alle Arten des nur denkbaren Ablebens, doch erfahren wir den Tod dabei nur noch fiktiv und kaum je real.
Entmenschlichung des Sterbens
Diese Entfremdung vom Sterben widerspiegelt sich auch in der Praxis: Nicht nur wird der Tod aus dem Alltag und der öffentlichen Debatte ausgeklammert, Schwerkranke und Sterbende werden in der Regel auch abseits der sozialen Zentren in Pflegekliniken und Sterbehospizen betreut, getrennt von Angehörigen, in oftmals anonymen Räumen durch technisches Equipment am Leben erhal- ten. Viele Patienten sind mit schwierigen medizinischen und ethischen Fragen konfrontiert, die sie allein nicht beantworten können. Zwar gibt es Ausnahmen wie die Maggie’s Centres in Grossbritannien, die eine ganzheitliche Betreuung und Vermittlung von verständlichen Informationen für Krebspatienten und deren Angehörige ins Zentrum stellen. Oder einige Privatkliniken in Frankreich, die in ihren Palliativzentren Lichtinstallationen des Designers Matthew LeHanneur einsetzen, um eine würdige Atomsphäre zu schaffen. Doch handelt es sich hierbei um Einzelfälle.
So öffnet sich ein zentrales Paradox der Wohlstandsgesellschaft, in der Gesundheit und individuelles Wohlbefinden zwar als höchstes Gut gelten, in der der Patient aber zusehends in den Hintergrund rückt. Während die Ausklammerung des «Faktors Mensch» bei einem chirurgischen Eingriff oder bei Röntgenaufnahmen verkraftbar scheint, öffnet sich beim Umgang mit dem Sterben für die Zukunft eine zunehmende Diskrepanz für das Gesundheitssystem und die Gesellschaft. Denn für den letzten Lebensabschnitt bedeutet Versorgungsqualität nicht primär technische Unterstützung, sondern vor allem Menschlichkeit und emotionale Betreuung. Diese «Entmenschlichung» der Versorgungsstrukturen dürfte sich angesichts der alternden Gesellschaft, der knapper werdenden Ressourcen und der dominanten Ausrichtung auf ein mechanistisches, biomedizinisches Modell der Medizin künftig noch verschärfen. Hinzu kommt, dass wir mit der schwindenden Bedeutung der Religionen in weiten Teilen der Gesellschaft keine kulturellen Rituale haben, die einen Menschen in den Tod begleiten. Die Bibel vermag es kaum noch, Antworten zu liefern und Trost zu spenden. Bis heute gibt es keine neuen Leitfäden, die uns dabei helfen, mit dem Sterben und dem Tod besser umzugehen. Das Ableben, nach dem es mit aller Kraft bekämpft wurde, wird als Scheitern angesehen und erfolgt im Vakuum.
Digitale Unsterblichkeit
Während wir in der physischen Welt seit Jahrhunderten versuchen, dem Tod zu entgehen, ist der vielleicht älteste Traum der Menschheit in der digitalen bereits Realität geworden: die Unsterblichkeit. In der binären Welt des Internets gibt es keine Vergänglichkeit. Informationen, Bits und Bytes haben keine Halbwertszeit, keine Alterserscheinungen. Das Internet vergisst nicht und gibt einmal veröffentlichte Einträge bekannterweise nicht mehr her, bis an unser Lebensende und darüber hinaus.
So schmeichelhaft diese digitale Unsterblichkeit zunächst erscheint, so anspruchsvoll sind die Herausforderungen, die sich daraus ergeben. Denn dass viele der unbedacht geposteten Einträge oder Bilder Teil unseres virtuellen Vermächtnisses sein werden, ist den meisten internetbegeisterten Zeitgenossen kaum bewusst. Unklar ist auch der Umgang mit sozialen Netzwerken, deren Profile zusehends intelligenter werden und künftig als eine Art «digitale Doppelgänger» selbstständig Freundesanfragen senden oder Einträge veröffentlichen werden. Vor diesem Hintergrund gilt es zu klären, was mit unseren Einträgen und unseren Nutzerprofilen passiert, wenn wir sterben. Lebt das Profil fort? Wird es zur Gedenk- stätte? Oder soll es gelöscht werden? Und wer entscheidet darüber?
Ohne diese Fragen zu klären, werden Profile aktiv bleiben und automatisch Aufforderungen zum Statusupdate senden, selbst wenn der Besitzer verstorben ist. Makaber, aber bereits Realität. In 40 oder 50 Jahren stehen wir möglicherweise vor dem Problem, dass Millionen von verwahrlosten Profilen noch immer online sind – auf der Suche nach Freunden oder Updates. Für Suchende wird es dann kaum noch ersichtlich sein, ob die Person im Netz noch lebt oder schon lange tot ist.
Vor diesem Hintergrund formulieren sich in den USA gegenwärtig Gruppierungen und NGOs, die sich dafür einsetzen, dass Familien die Kontrolle über digitale Profile erhalten, wenn ein Angehöriger stirbt. Facebook hat sich bislang erfolgreich selbst gegen Initiativen gewehrt, die Nutzern den Ausstieg aus der digitalen Welt erleichtern wollten. Ein Programm von holländischen Designern, die «Web 2.0 Digital Suicide Machine», das auf Wunsch eines Profilbesitzers alle Einträge aus Face- book, Twitter oder Linkedin und Co gelöscht hat, wurde letztlich in die Knie gezwungen1. Bis 2010 hatte das Programm bei über 1000 virtuellen Selbstmorden assistiert, dabei 80 500 Freundschaften gekündigt und 276 000 Twitterfeeds eliminiert.
1 suicidemachine.org/download/Web_2.0_Suicide_Machine.pdf
Während wir also im echten Leben den Tod abwenden wollen, die Auseinandersetzung damit vermeiden und un- ser Lebensende oft nicht so erleben können, wie wir es uns wünschen, stehen wir im digitalen Leben vor dem Prob- lem der Unsterblichkeit und dem Entscheidenmüssen, was von uns bleiben und was man aktiv sterben lassen soll.
Das Ende neu denken
Mit Blick auf die doppelte Herausforderung mit dem Tod scheint es, als müssten wir das Sterben sowohl in der realen wie auch in der digitalen Welt neu erlernen. Dazu gilt es, Debatten über den Umgang mit dem Tod zu fördern und gemeinsam herauszufinden, was Lebensqualität für uns bedeutet und wann wir bereit sind, Abschied zu nehmen. Gleichzeitig gilt es Wege zu finden, um mit der Unvergänglichkeit unserer digitalen Geschichte umzugehen und einfacher zu entscheiden, was von uns bleiben soll und was nicht.
Das Resultat davon ist eine höhere Lebensqualität, vielleicht sogar Zufriedenheit bis ans Ende unseres Lebens. Aber nicht nur. Eine aktive Auseinandersetzung mit dem Tod würde auch dazu führen, die Ressourcen im Gesundheitssystem effizienter einzusetzen und dadurch die hohen Kosten der letzten Lebensmonate einzu- dämmen. Darüber hinaus stellt die Gestaltung des letzten Lebensabschnitts einen der vielleicht grössten Wachstumsmärkte dar, der neben den Therapien und der Gesundheitsförderung noch kaum entwickelt ist und dessen Angebote von ganzheitlicher medizinischer Betreuung bis hin zu Technologien wie intelligenten Wohnungen und Pflegerobotern reichen könnten. Insofern gilt es aus verschiedenen Gründen neu über das Sterben, und damit auch über das Leben, nachzudenken sowie Strukturen und Werthaltungen entsprechend anzupassen. Hierfür fünf Handlungsfelder:
1. Bewusstsein schaffen – die Dinge erkennen, die wirklich zählen. Im Zentrum der Fragen um die Zukunft des Sterbens steht die Auseinandersetzung mit uns selbst – mit der Tatsache unserer Endlichkeit. Es geht dabei darum, schon frühzeitig zu entscheiden, was uns im Leben wich- tig ist, zu identifizieren, wofür es sich lohnt, Zeit, Geld und Energie aufzubringen. Die Beschäftigung mit unse- rem digitalen Selbst kann bei der Entscheidungsfindung im realen Leben helfen, denn sie stärkt unser Bewusst- sein dafür, dass wir etwas hinterlassen und dass wir es letztlich sind, die entscheiden, was das ist.
2. Das Umfeld für den letzten Lebensabschnitt neu gestalten – jenseits der Medizin denken. Die Neugestaltung des Sterbens bedingt eine Umgebung, die nicht die Medizin, sondern den Menschen ins Zent- rum stellt – von der Gestaltung von Räumen bis zur Art und Weise der Betreuung. Das Schaffen einer menschbe- zogenen Umwelt bedingt eine andere Logik als die eines auf Effizienz getrimmten Spitals. Was bei der Optimierung von chirurgischen Eingriffen die Qualität erhöht, gilt nicht automatisch für die Betreuung am Lebensende. Voraussetzung für ein solches Umfeld ist es, eine persönliche Gestaltung zu ermöglichen, das Zusammensein mit Familienangehörigen zu vereinfachen und den Fokus der Pflege von der Versorgung des Körpers auf eine emotio- nale Betreuung auszurichten. Dies bedingt zum einen Zeit, zum anderen Angebote, die den sozialen und geisti- gen Austausch fördern – am Patientenbett genauso wie im Internet. Sich mit dem Umfeld des Sterbens zu beschäftigen bedeutet aber auch, den konkreten Ort des Sterbens zu überdenken. So geben mehr als die Hälfte der Menschen bei Befragungen an, dass sie lieber zu Hause sterben würden als in einer dafür eingerichteten Insti- tution. 2 Das Sterben humaner zu machen erfordert nicht, die bestehenden Strukturen von Grund auf neu zu erfinden, sondern diese vor dem Hintergrund knapper Res- sourcen auf die Bedürfnisse und das Wohlbefinden des Einzelnen auszurichten. Was dies im Einzelfall bedeutet, muss von Fall zu Fall angepasst werden und erfordert lernende Strukturen, die sich laufend weiterentwickeln.
3. Das Lebensende in den Alltag bringen – Austausch zwischen Lebenden und Sterbenden fördern. Die Ausklammerung von Alter, Krankheit und Tod ist zu einem wesentlichen Teil Folge der Gestaltung unseres Alltags, bei dem alte Menschen kaum noch mit der aktiven Generation der erwerbstätigen Bevölkerung oder mit Kindern zusammentreffen. Eine Voraussetzung, um mehr Bewusstsein und Verständnis zu schaffen, sind Konzepte, die ein Zusammentreffen unterschiedlicher Generationen fördern. Dies umfasst den Bau von Siedlungen, in denen bewusst junge und alte Menschen woh- nen, sich möglicherweise auch die Infrastruktur teilen und gegenseitig Unterstützungsleistungen bieten: Alte Menschen helfen jungen Familien bei der Kinderbetreuung, diese unterstützen im Gegenzug die Älteren im Haushalt. Auch die Wirtschaft spielt bei der Förderung des Generationenaustauschs eine tragende Rolle. Mit dem Einsatz von älteren Angestellten – möglicherweise in Teilzeitpensen und zu tieferen Löhnen – könnten Un- ternehmen Mitarbeiter mit viel Erfahrung weiterhin nut- zen und gleichzeitig einen Beitrag für eine nachhaltige Kultur des Altwerdens leisten.
2 www.ncpc.org.uk/sites/default/files/NCPC_Future_Forum_ Evidence_May_2011.pdf
4. Eine neue Kultur des Abschiednehmens entwickeln – Sicherheit vermitteln. In der Individualgesellschaft haben sich uns unendliche Möglichkeiten eröffnet, unser Leben – und auch unser Ableben – zu gestalten. So wird im Zusammenhang mit Trends im Markt des Sterbens immer wieder von lustigen Sargkreationen im Harley-Davidson-Stil oder mit Fussballclublogos berichtet. Diese Freiheit bringt aber auch Unsicherheit, denn immer mehr Menschen wissen nicht mehr, woran sie sich halten sollen. Auch geht in der Folge die Gemeinsamkeit in der Gesellschaft verloren. Die religiösen Riten, welche diese Funktion über lange Zeit wahrgenommen und dabei auch eine gesellschaftliche Klammer gebildet haben, gelten für die meisten nicht mehr. Entsprechend gilt es, über neue Rituale, Werte oder Protokolle nachzudenken, die einerseits Individualität ermöglichen und auf die heutige Gesellschaft zugeschnitten sind, gleichzeitig aber in einem breiteren Kontext Sicherheit stiften und Sterbenden wie auch Verbleibenden helfen, Trost spenden und Antworten liefern.
5. Verantwortung übernehmen – Abschied nehmen geht nicht allein.
Im Kern geht es am Lebensende aber weder um Prozesse noch um Strukturen oder Design, sondern um Menschen. Die Verantwortung dafür, dass ein Mensch nicht allein stirbt, kann nicht an Institutionen delegiert werden; sie bleibt bei den Angehörigen und Freunden. Das bedeutet, dass wir alle die Bereitschaft auf uns nehmen müssen, uns bereits im aktiven Teil unseres Lebens mit dem eigenen Schicksal auseinanderzusetzen. Letztlich ist eine persönliche Betreuung nur durch den Menschen möglich. Die Individualisierung von Produkten und die Gestaltung von agilen Prozessen sind zwingend für ein humaneres Sterben. Im Zentrum steht aber die Verbindung zwischen Menschen und Strukturen, die dieses den Angehörigen und Pflegenden ermöglichen. Vor allem aber der Wille und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen.
Hlin Helga Gudlaugsdóttir ist Designerin und Lehrbeauftragte an der Kunsthochschule Konstfack in Stockholm. In den letzten Jahren galt die Aufmerksamkeit ihrer Arbeit zunehmend der Palliativmedizin – der Behand- lung von Patienten, deren Erkrankung nicht mehr auf eine kurative Behandlung anspricht. In interdisziplinärer Weise, doch immer auch mit dem Blick einer De- signerin, widmete sie sich der Frage, bei der neben der Beherrschung von Schmerzen die Wünsche, Ziele und das Befinden des Patienten im Vordergrund stehen. www.konstfack.se
Stephan Sigrist ist Gründer und Leiter von W.I.R.E. und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Entwicklungen der Life Sciences sowie mit langfristigen Trends in Wirtschaft und Gesellschaft. Zudem ist er Autor zahlreicher Bücher, berät Unternehmen und politische Institutionen in strategischen Belangen und ist regelmässiger Referent auf internationalen Tagungen.