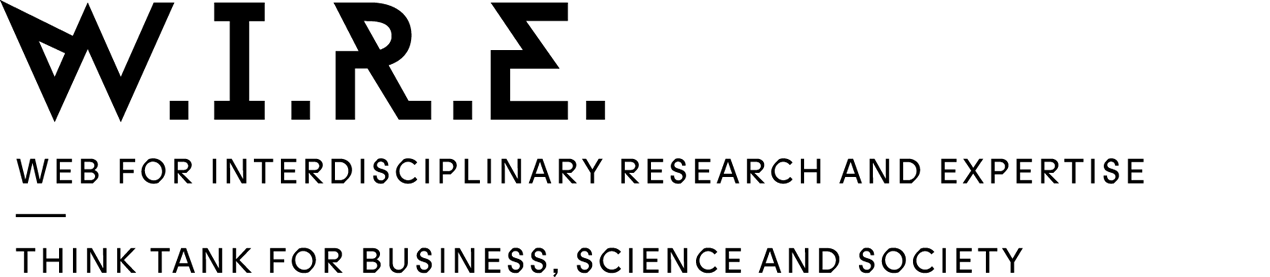Das Ende des Gehorsams. Gespräch mit Theo Wehner
Von Simone Achermann
Computer sollen gehorchen, Menschen nicht. Um uns von intelligenten Maschinen abzugrenzen, brauchen wir ein hohes Mass an Fantasie und Individualität, sagt Theo Wehner, Professor für Arbeitspsychologie an der ETH Zürich. Daher sind die Jobs der Zukunft auch nicht in der Wirtschaft zu suchen, sondern in jedem Einzelnen von uns.
Herr Wehner, wie wird sich die Arbeit in den nächsten Jahrzehnten verändern?
Wir dürfen oder müssen wohl alle weniger arbeiten. Die Automatisierung hat schon in der Vergangenheit zur dramatischen Verdichtung und Rationalisierung von Arbeit geführt. Wir brauchen heute noch die Hälfte der Menschen, um das zu verrichten, was wir vor dreissig Jahren geschafft haben. Das wird in dreissig Jahren noch extremer sein.
Der «Economist» schreibt, dass bis in 20 Jahren gar die Hälfte aller Jobs in den USA von Maschinen verrichtet werden könnte. Ist das realistisch?
Ich denke schon. Dort, wo man automatisieren kann, werden es sogar deutlich mehr sein. Die Autoindustrie oder die Montage von Kühlschränken beispielsweise wird bis zu 90 Prozent automatisiert sein. Das ist der Lauf der Technik: Bevor 1951 die erste Autowaschanlage in Seattle in Betrieb genommen wurde, gab es in den USA knapp 1 Mio. Autowäscher; 1970 lag die Beschäftigungsquote nahe null: Man(n) wäscht selbst oder fährt selbst durch die Waschanlage!
Könnten auch Wissensarbeiter wie Journalisten oder Professoren ersetzt werden?
Um zu automatisieren, muss man die Aufgaben zuerst so weit standardisieren und trivialisieren, dass sie maschinell produzierbar werden. Im Journalismus sind wir bald schon so weit. Bereits heute bergen viele Artikel keine eigene journalistische Expertise. Ist ein Text aber nur noch eine mehr oder weniger sinnvolle Komposition von Daten und Informationen, kann er geradeso gut durch Algorithmen generiert werden. Dies gilt ebenso für wissenschaftliche Artikel. Was steht denn heute in unseren Peer Reviewed Journals an persönlichen Ideen oder kreativen Äusserungen drin? Jeder Gedanke, zu dem es keine Referenz gibt, fliegt raus. Wissenschaftliche Arbeiten sind bereits so stark «mcdonaldisiert», dass wir sie in ein paar Jahren vom Computer schreiben lassen können.
Welche Arbeit wird nie von Maschinen verrichtet werden?
Sämtliche Arbeit, deren Fokus auf den Human Relations liegt. Kundenberater oder Psychotherapeuten werden nicht ersetzt werden. Emotionsarbeit lässt sich nicht automatisieren. Doch die Automatisierung verdrängt sie ein Stück weit. Denken wir zurück an das Waschen am Dorfbrunnen, ja selbst in den städtischen Waschhäusern: Frauen haben dort nicht nur gewaschen. Sie haben ihre Freuden und sicher öfter noch ihre Sorgen und Nöte besprochen und miteinander geteilt. Es war ein sozialer Ort, ja fast ein therapeutisches Setting. Die Orte, an denen heute Waschmaschinen und Tumbler stehen, eignen sich hierfür nicht mehr. Wobei wir übrigens heute – auch ohne Waschzwang – eher mehr Zeit mit dem Waschen verbringen als je zuvor.
Entstehen auch neue Tätigkeiten durch die Automatisierung?
Momentan jede Menge Resttätigkeiten. Tätigkeiten, die sich jeweils noch nicht automatisch verrichten lassen und häufig von sogenannt weniger qualifizierten, meist fremdländischen Arbeitskräften ausgeführt werden und beim nächsten Automatisierungsschub wieder wegrationalisiert werden. Die Abfallentsorgung ist ein Beispiel dafür; die Wagen können heute die Mülltonnen automatisch aufnehmen, sie «richtig» zu platzieren ist die Resttätigkeit, die wir noch selbst verrichten müssen.
Und sonst entstehen in Zukunft keine neuen Arbeitsplätze?
Sicher doch. Und zwar durch jene, die heute schon die eigentlichen Arbeitgeber sind: jeder Einzelne von uns, der nicht wegen körperlicher Gebrechen oder seelischer Leiden arbeitsunfähig ist. Um neue Arbeitsplätze zu schaffen, dürfen wir nicht darauf warten, bis die Wirtschaft sie anbietet. Ein Unternehmer ist genau an so vielen Arbeitsplätzen interessiert, wie er zur Herstellung von marktgängigen Produkten oder Dienstleistungen benötigt. Wir müssen die Tätigkeiten und Betätigungsfelder der Zukunft selber kreieren; durch mehr individuelle Kreativität, mehr Selbstständigkeit und Unternehmergeist. In der Schweiz gibt es eine Initiative, die in dieser Hinsicht ein äusserst interessantes Denkangebot macht: das bedingungslose Grundeinkommen. Hierbei würden Arbeit und Einkommen radikal voneinander getrennt. Das wäre historisch neu – und würde eine grosse Herausforderung, wenn nicht gar eine anfängliche Überforderung für die meisten von uns darstellen. Doch es wäre eine Basis für sehr viel mehr Fantasie. Dadurch, dass die Existenz gesichert wäre, hätten wir mehr Zeit und die
Gelassenheit, um nicht nur über andere Waren, sondern über die wahren Bedürfnisse des Individuums sowie der Gesellschaft nachzudenken und unsere Arbeit entsprechend auszurichten. Wie genau wir mit der neu gewonnenen Freiheit umgehen würden, weiss ich nicht. Aber einfache Arbeit müsste entweder attraktiver, wegrationalisiert oder von jedem von uns selbst ausgeführt werden. Lohnabhängige, die auf schlechte Arbeitsplätze, mitunter sogar auf zwei oder drei solcher «poor Jobs» angewiesen wären, gäbe es dann sicher nicht mehr in so hoher Zahl.
Wodurch zeichnen sich diese selbstständigen Tätigkeiten aus?
Durch mehr Individualität, schöpferische Kraft und persönliches Engagement. Wir müssen – auch ohne Aussicht auf ein bedingungsloses Grundeinkommen – wieder beginnen, an den eigenen Bedürfnissen, Vorstellungen und Fähigkeiten anzusetzen, statt uns primär an Ausbildungsversprechen und am Stellenmarkt zu orientieren. Berufswechsel gehen selten entlang der Erfahrung und der eigenen Wünsche, sondern entlang der Angebote an Weiterbildungsmöglichkeiten. Dies liegt daran, dass jede Gesellschaft die jungen Menschen dazu bewegt, das zu reproduzieren, was diese Gesellschaft ausmacht. Und das ist in den meisten Gesellschaften, einen Beruf zu erlernen mit hohen Chancen auf eine Anstellung. Dass wir heute überhaupt noch von Berufen reden! Berufsgesellschaft – so wissen Soziologen – war im späten Mittelalter, Entberuflichung ist heute. Das zeigt uns doch beispielsweise der Bürgerjournalismus aus Krisengebieten, auch wenn er nicht in HD-Qualität daherkommt. Wer heute noch glaubt, Professionalisierung würde die Spitze des Wissens anzeigen, liegt komplett falsch. Gerade unter Nutzung neuer Technologien sind wir auf dem Weg zur Professionalisierung des Jedermann; ebenfalls eine nicht ganz junge soziologische Theorie, die sich gut belegen lässt: Twittern, Googeln, Bloggen werden nicht berufsmässig ausgeübt. Der Amateurstatus ist die angemessene Expertise und hat nicht nur LINUX hervorgebracht.
An technischen Hochschulen werden aber genau solche Fachkräfte mit engstem Fokus ausgebildet.
Stimmt, der Akzent liegt auf dem rein Fachlichen. Daher hat unsere Hochschule, die ETH, auch zum «Critical Thinking» aufgerufen; wobei ich lieber von «Critical Teaching» sprechen würde. Denn: Warum sind die Studenten – das wurde der Schulleitung aus der Praxis rückgemeldet und war der Auslöser der Initiative – nicht kritisch? Weil sie die unzähligen Prüfungen viel besser bestehen, wenn sie sich den Stoff unkritisch, bzw. mechanisch aneignen. Wer auswendig lernt, was andere gedacht haben, wird durch gute Noten belohnt. Wieweit ich konvergent, also in die Tiefe denken muss, um in der Praxis meist divergent – also über die Fachgrenzen hinweg – handeln zu können, das ist heute die grosse Frage und kann nur von jenen beantwortet werden, die sich nicht einzig auf ihr Fachwissen stützen.
Professoren müssen das Lehr- und Prüfungssystem ändern. Was können Unternehmen für kreativere Mitarbeiter tun?
Sie müssen sie herausfordern, die Mitarbeitenden. Sie sollten nicht vorgeben, es gebe funktionierende, stabile Systeme, sondern verlangen, dass Instabilität weiter gestaltet und das Unerwartete gemanaged wird. Wir brauchen lernbereite Organisationen, nur dann werden die neuen Technologien nicht zur Bedrohung, sondern zur Herausforderung. Das Management des 20. Jahrhundert war darauf konzentriert, Prozesse zu beherrschen und Job Descriptions zu fixieren. Diesen Fokus müssen wir ablegen. Der ehemalige CEO von Novartis hat mit dem Novartis- Campus etwas Neues gewagt. Nicht nur die Grossraumbüros und Labore, sondern auch das Areal ist so angelegt, dass sich Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen und über Hierarchiegrenzen hinweg zufällig begegnen, informell austauschen können, voneinander lernen und so neue Ideen schöpfen. Das ist ein guter Ansatz. Allerdings müssen auch die Aufgaben neu definiert werden. Bislang arbeiten die meisten sogenannten Wissensarbeiter – nicht nur bei Novartis – Excel-Sheets ab und begegnen in Tat und Wahrheit kaum jemandem per Zufall. Wie viel Chaos ein Unternehmen verträgt und wie viel Kontrolle es braucht, weiss zum jetzigen Zeitpunkt niemand. Wir müssen es erst lernen, indem wir anfangen, die Strukturen zu lockern. Allerdings kommen heute noch die meisten Menschen bereits in einen Betrieb mit einem hohen Anspruch an Stabilität und sind nicht bereit, ein gewisses Mass an Instabilität zu akzeptieren oder gar mitzugestalten.
Wie können wir das ändern?
Indem wir die Möglichkeiten der Mitgestaltung endlich ernst nehmen und die Sinnsuche nicht auf den Feierabend verschieben oder alleine in Hobbys vermuten, sondern am Arbeitsplatz beginnen. Zwei Drittel der Leute sagen bereits, sie würden für einen sinnvolleren Job Status oder Geld opfern. Das ist eine massive Kritik an den bestehenden Arbeitsstrukturen, die mir aber gleichzeitig Hoffnung macht, weil es eine Herausforderung für die Arbeitspsychologie und die Technikwissenschaften ist.
Fassen wir zusammen: Wie sollte die Arbeitswelt in Zukunft aussehen?
Wir müssen unsere Ansprüche an ein gutes Leben erhöhen. Das heisst, wir brauchen bessere Produkte und humanere Dienstleistungen. Und wir müssen einsehen, dass diese nur zu erreichen sind durch sinngenerierende Arbeitsplätze mit anspruchsvollen, fantasiefordernden Aufgaben und exzellenter Technologie, die wohl jenseits von Microsoft und SAP zu suchen sein wird.
THEO WEHNER ist Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der ETH Zürich. Nach seinem Studium der Psychologie und Soziologie an der Universität Münster promovierte er an der Universität Bremen und habilitierte sich 1986 ebenfalls dort. Von 1989 bis 1997 war er Professor für Arbeitspsychologie an der TU Hamburg-Harburg. In seiner Forschung ist ein sowohl quantitatives als auch qualitatives empirisches Vorgehen zentral, jedoch immer eingebettet in die betriebliche Lebenswelt und in enger Kooperation mit den Vertretern der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite.