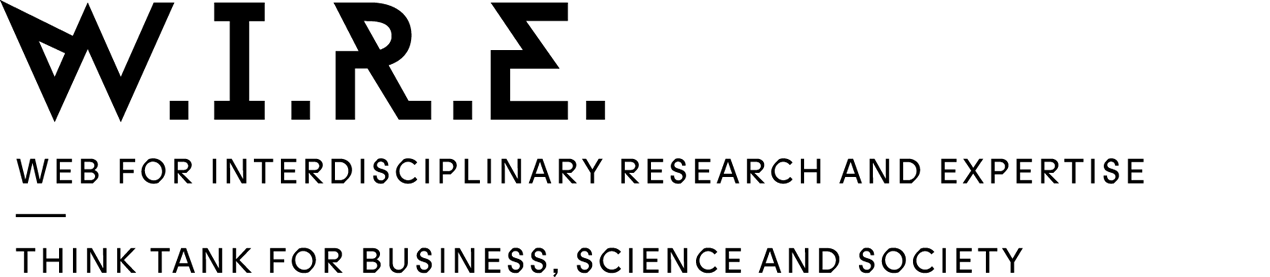Hacken Sie Ihre Wohnung! Gespräch mit Konstantin Grcic
Von Simone Achermann
Mit dem wachsenden Platzmangel in urbanen Zonen, der sinkenden Sesshaftigkeit und unserer Dauerverkabelung wird Privatheit ein zunehmend rares Gut. Um sie auch in Zukunft noch zu gewährleisten, sagt der Designer Konstantin Grcic, müssen wir selber aktiv werden und unsere Städte, Wohnungen und Möbel hacken.
Konstantin Grcic, Sie haben sich für Ihre Ausstellung «Panorama» im Vitra Design Museum intensiv mit Räumen der Zukunft beschäftigt. Wie wohnen wir morgen?
Ich glaube, dass gewisse Funktionen einer Wohnung in Zukunft ausgelagert werden, zum Beispiel das Badezimmer oder die Küche. Gerade als Stadtbewohner kann ich ja auch ins Schwimmbad oder in den Fitnessclub gehen, um zu duschen. Auch kochen muss ich nicht mehr selbst. Künftig könnten sogar gezielt noch mehr solche öffentlichen Räume gebaut werden, die erst noch besser ausgestattet wären als meine heutigen daheim. So erhielten wir mehr Freiraum, um unseren privaten Bereich noch privater zu gestalten. Dies wird zunehmend wichtiger, da in den Städten immer weniger Platz für den Einzelnen zur Verfügung stehen und der noch verbleibende so wertvoll und teuer werden wird, dass man ihn nur noch mit wirklich Wichtigem füllen will. Allerdings geht es mir nicht darum, die Zukunft vorherzusagen. Mein Ziel ist es, die Gegenwart und die heutige Wohnkultur zu hinterfragen. Das heisst: unsere Köpfe für neue Ideen zu öffnen. Wenn es aber nach mir ginge, wohnen wir in Zukunft wesentlich reduzierter.
Was soll in einer Wohnung denn noch bleiben?
Zunächst das, was einem selbst am wichtigsten ist. Das ist natürlich subjektiv. Ich denke aber, es handelt sich dabei fast immer um Objekte, die eine Geschichte erzählen und die einem das Gefühl geben, zu Hause zu sein. Das können Fotos sein, Bücher, ein Wecker oder ein Sessel. Gerade Möbel werden mit der Zeit ja beinahe zu «creatures»; man weist ihnen eine Art Persönlichkeit zu – vielleicht, weil viele von ihnen vier Beine haben. Darüber hinaus muss in jeder Wohnung natürlich auch eine gewisse Grundinfrastruktur bestehen bleiben. Gleichzeitig ist das Wohnen in Zukunft immer mehr an den Umstand gekoppelt, dass wir den Wohnort oft wechseln, nicht mehr so sesshaft oder zumindest sehr häufig unterwegs sein werden.
Um dies zu versinnbildlichen, haben wir in der Ausstellung eine Art Plug-and-Play-Modul entwickelt. Dies ist eine mobile Struktur, die mit Tragegriffen transportiert und jederzeit überall wieder neu konfiguriert und aufgebaut werden kann. Darin integriert ist eine technische Versorgungseinheit, die Stromzufuhr, Heizung, Klimaanlage, Wi-fi und WLAN beinhaltet.
Wie schafft man es, Wohnungen individueller zu gestalten? Wenn wir die Entwicklung im Möbelmarkt anschauen, so werden Massenprodukte ja immer dominanter.
Das stimmt, allerdings sind die grossen Möbelhäuser notwendig, um den Bedarf nach Wohnobjekten zu stillen. Und die Vielfalt des Angebots erlaubt es, in der Kombination Räume individuell einzurichten. Allerdings auch oftmals Schein-individuell. Spannend ist in diesem Zusammenhang das Phänomen Airbnb: eine digitale Plattform von privaten Wohnungen, die man überall auf der Welt unkompliziert mieten kann. Die Ursprungsidee dabei war ja, dass man so gewissermassen in ein echtes Leben eintauchen kann. Mit dem Erfolg und dem rasanten Wachstum der Plattform ist allerdings auch eine neue Kategorie von Wohnungen entstanden, die nur noch dem Zweck des Vermietens dienen und in der Folge ganz eigenartig eingerichtet werden. Die Möbel geben oft Individualität und Persönlichkeit vor, entsprechen aber bloss Klischees. So entsteht ein für mich persönlich frustrierender Mix aus vermeintlicher Heimeligkeit und pflegeleichter Funktionalität wie in einem Hotelzimmer. Mit dem Erlebnis, zu Gast bei jemandem zu sein, und mit dem Vertrauen, das dafür die Grundlage wäre, hat es aber nichts mehr zu tun. Für viele Städte stellt übrigens auch bereits ein Problem dar, dass immer mehr Wohnungen, oftmals ganze Häuser, ständig wechselnden Leuten zur Verfügung stehen, während sie für die Menschen, die eigentlich in diesen Städten leben, gar nicht mehr zugänglich sind. Airbnb ist somit ein Beispiel für eine wirklich gute Anfangsidee, die sich aber verselbständigt hat und zu einem Riesenproblem wurde, indem sie ganze Nachbarschaften anonymisiert und letztlich den Zusammenhalt in städtischen Gemeinschaften erschwert. Dabei wäre der heute notwendiger denn je: Je grösser und anonymer die Städte, desto wichtiger wird der Austausch in der Nachbarschaft.
Wie können wir den sozialen Austausch zwischen Bewohnern wieder fördern?
Die Basis dafür finden wir in traditionellen Wohnformen, in denen in einem Haus verschiedene Parteien wohnen, die sich austauschen und einander helfen. Das ist aus meiner Sicht nicht altmodisch, sondern moderner denn je. Und es wird angesichts der schnell wachsenden Massstäbe von Städten z. B. in China noch viel wichtiger werden.
Wohnungen werden mit dem «Internet der Dinge» intelligent. Möbel sind künftig mit Sensoren und Mikrochips ausgerüstet und sollen uns helfen, unser Leben zu erleichtern. Ist das wünschenswert?
Im Moment ist die Bedeutung dieser digitalen Infrastruktur noch unklar. Entwickeln wir diese Dinge, weil wir es können oder weil wir sie tatsächlich brauchen? Ich bin der Ansicht, dass es vielleicht besser wäre, unsere Möbel rein zu halten von Technologie. Elektronik hat ja eine Halbwertszeit von nullkommanichts, und gerade die persönlichen Dinge, von denen ich bereits sprach, zeichnen sich oftmals dadurch aus, dass sie explizit «langsam» sind: Ein Stuhl ist auch in 100 Jahren noch ein Stuhl, auf dem ich sitzen kann. Wenn man aber einen Haufen Elektronik in ihn eingebaut hat, ist er unter Umständen in drei Jahren bereits nicht mehr aktuell, disqualifiziert sich also quasi selbst.
Gleichzeitig stellt sich aber die Frage, ob ein interaktiver Stuhl nicht umso persönlicher werden könnte, weil er mich erkennt und zum Beispiel selbstständig die Position vor dem Fenster einnimmt, die ich mir bei einer bestimmten Lichtstimmung wünsche.
Ja, das stimmt, solche Dinge sind an sich nicht uninteressant. Ich habe trotzdem eine gewisse Abneigung dagegen. Ich brauche keinen Stuhl, der meinen Blutdruck misst oder mir sagt, ich solle mehr trinken. Ich merke selber, wenn ich einen Flüssigkeitsmangel habe. Auch glaube ich, dass dieses permanente Monitoring einen ständig hinterfragen lässt, ob man gerade das Richtige tut. Das nimmt dem Leben auch Leichtigkeit. Ich weiss: Viele Menschen sind da viel offener als ich. In meinem Freundeskreis beispielsweise gibt es viele, die nur noch nach den Anweisungen irgendwelcher Apps leben, essen und trainieren. Und ich will mich dem Ganzen auch nicht völlig versperren. Allein das Smartphone ist ja ein gutes Beispiel dafür, wie nützlich technologische Erneuerung sein kann – auch wenn ich sehr froh bin, dass mein Telefon immer noch ein Objekt ist, das ich auch einfach mal zu Hause lassen oder zumindest abschalten kann. Sobald wir das nicht mehr können, weil wir zum Beispiel anfangen, uns die Dinge zu implantieren, werden wir immer mehr in den Sog der Technik geraten. Schon jetzt, mit dem Smartphone, checken ja ständig alle ihre E-Mails. Ich denke, wir müssen aufpassen, diesen Zwang nicht noch weiter zu verstärken.
Müsste die Wohnung der Zukunft also eigentlich der Rückzugsort sein, an dem wir endlich einmal unverkabelt sein können?
Gemessen an der Nervosität, die mich befällt, wenn ich mal für zwei Tage an einen Ort komme, an dem es kein Internet gibt, würde ich sagen: Der absolute Verzicht auf Vernetzung mit der Aussenwelt kann nicht die Lösung sein. Aber man muss unbedingt die Entscheidung treffen können, ob man sich mit ihr verbinden will oder nicht.
Wir sprachen jetzt viel von der Reduktion in Wohnräumen. Gleichzeitig geschieht auch das Gegenteil: Immer mehr Menschen pflanzen Tomaten auf ihren Hausdächern an und produzieren Strom mit hauseigenen Solarzellen. Wozu führt dieser Wunsch nach Autarkie?
Die Tendenz hin zu mehr statt zu weniger Funktionalität ist durchaus auch zu beobachten. Das hängt – gerade beim selbst angebauten Essen – stark mit dem sinkenden Vertrauen in die Industrie zusammen: Man weiss nicht genau, woher die Produkte kommen, die man kauft, wie biologisch sie sind etc. Gleichzeitig steckt hinter dem Bestreben nach mehr Autarkie auch ein Bedürfnis nach ökologisch verträglicheren Lösungen. Allerdings wäre die Komplexität einer wirklich autarken Lebensweise für den Einzelnen kaum handhabbar. Die Tendenz zur Selbstversorgung hat aber nicht nur mit dem Misstrauen gegen äussere Strukturen zu tun. Dahinter steht auch eine Art soziale Ökologie. Ein Gefüge, bei dem es um das Teilen geht, in dem man sich austauscht und Verantwortung füreinander übernimmt. An sich ein sehr guter Ansatz, vor allem, wenn nicht jede Wohneinheit ihren eigenen Garten bewirtschaftet, sondern ein ganzer Strassenzug gemeinschaftlich. Das ist zudem effizienter und kann erst noch den Gemeinschaftssinn stärken, von dessen Schwinden wir bereits gesprochen haben. Allerdings birgt das Ganze auch Gefahren. Denn sobald ich eine Aufgabe in einer Gemeinschaft übernehme, bedeutet das auch, dass ich unter Beobachtung stehe, einem zusätzlichen Druck, alles richtig zu machen, weil ich sonst womöglich sozial sanktioniert werde. Dies widerspricht jedoch genau dem, was Privatheit ausmacht: einen Raum zu haben, in dem man loslassen, Fehler machen, in Unordnung leben und auch hässliche Dinge aufstellen kann, ein kleines Refugium also jenseits der glänzenden Facebook-Profile, auf denen so vieles geschönt, retuschiert oder gelogen ist.
Was können Designer oder auch Massenmöbelhersteller wie Ikea tun, um genau diese Privatheit und die damit verbundene Stärkung der Persönlichkeit zu ermöglichen?
Ich denke, das ideale Möbel wäre eigentlich eines, in das man sich «reinhacken» – es also selbst verändern und anpassen – kann: Es bietet eine Grundstruktur, und darauf aufbauend kann ich es so gestalten, dass es für mich persönlich funktioniert und meinem Geschmack entspricht. Das Problem dabei aber ist: Wenn man das Hacking in einen kommerziellen Rahmen stellt, wird es künstlich. Dabei ist es ja vor allem deshalb reizvoll, weil es sich gegen den Markt, gegen den Kommerz richtet. Es bleibt also viel mehr zu wünschen, dass diese Gegenkultur auch in Zukunft immer etwas finden wird, das sie hacken kann. Ikea-Möbel sind dafür im Grunde jetzt schon sehr gut geeignet: Sie sind schlicht, anonym, in Einzelteile zerlegbar – und vor allem erschwinglich, so dass man sich auch einmal eine Fehlkonstruktion leisten kann, ohne allzu viel Geld zu verlieren.
Sollte man das Prinzip des Hackings auch auf die Stadtentwicklung übertragen?
Ja, unbedingt. In Barcelona gab es während der Olympiade einen cleveren Stadtplaner, der Teile der Stadt quasi als Open-Source-Projekt betrachtete, das die Bewohner selbst ausbauen und permanent verändern, im Grunde für sich «hacken» konnten. So entstanden zwar keine HighEnd-Shoppingstrassen, aber Eigendynamiken, die viel wertvoller sind als alles, was man in einem grossen Wurf planen könnte: Kleingewerbe, Künstler, Kindergärten usw. fanden ihren Platz. Wir sollten solch offene Strukturen viel häufiger ermöglichen. Wenn man selber Teil wird von etwas, sich einbringen kann, wird es nämlich auch zu etwas Persönlichem, mit dem man sich identifiziert. Und dadurch werden quasi wie von selbst ganz viele Probleme gelöst, die besonders den städtischen Raum betreffen: Leute pflegen ihre Häuser, Vorplätze und die sonstige Umgebung mehr, anstatt sie verkommen zu lassen.
KONSTANTIN GRCIC ist ein deutscher Designer. Nach seiner Ausbildung an der John Makepeace School zum Möbelschreiner studierte Grcic am Royal College of Art in London Industriedesign. Nach einem Jahr als Assistent von Jasper Morrison gründete er 1991 in München sein Designbüro KGID (Konstantin Grcic Industrial Design). In der Folge entwarf er im Auftrag zahlreicher Hersteller Möbel, Leuchten und Accessoires. Einige Entwürfe wurden in die Sammlung des Museum of Modern Art in New York aufgenommen. Bis Mitte September 2014 zeigt Konstantin Grcic seine Visionen vom Wohnen und Leben der Zukunft in der Ausstellung «Konstantin Grcic – Panorama» im Vitra Design Museum.