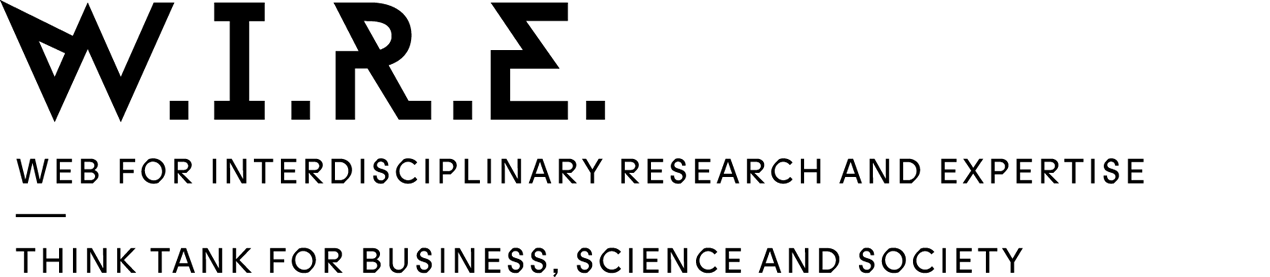Langlebig? Langweilig! Von Barbara Bleisch
Das, woran uns wirklich etwas liegt, gibt uns Grund, lang und länger zu leben. Darum streben wir auch danach, immer älter zu werden. Vielleicht zu Unrecht. Denn: Je länger wir leben, desto weniger Gründe haben wir, um am Leben bleiben zu wollen.
Die griechischen Götter, die in der Welt der Sagen den Olymp bewohnten, hatten es gut: Sie brauchten den Tod nicht zu fürchten, denn sie lebten lange, genau genommen: unendlich lange. Aber es versteht sich von selbst, dass eine endlose Lebensspanne auch ihre Längen hat, und böse Zungen behaupten, die Götter hätten sich vor lauter Langeweile die Köpfe eingeschlagen, einander Meeresungeheuer auf den Leib gehetzt und ganze Heerscharen an Nachwuchs gezeugt. Wer so lange lebt, muss sich einiges einfallen lassen, um lebenslustig zu bleiben, denn in der ewigen Repetition werden selbst der attraktivste Strandurlaub, die leidenschaftlichste Affären, die anregendsten Gespräche öd. Selbst mehr vom Besten ist irgendwann mehr vom Gleichen – ganz abgesehen davon, dass sich bei uns Menschen auch Liebeskummer, Magendarminfekte und Misserfolge in die Repetitionsschlaufe einfügen würden. Weshalb also weiter leben, wenn man das Leben gesehen hat?
Wer die Frage so stellt, setzt voraus, dass man das Leben irgendwann gesehen hat. Ein Beweis lässt sich für diese Voraussetzung nicht antreten. Allerdings lässt sich ebenso wenig zeigen, dass es einen von unserer Lebenslust unabhängigen Grund gibt, ewig am Leben zu bleiben. Denn unsere Wünsche, die wir im Laufe eines Lebens hegen, erlöschen in dem Moment, in dem wir sterben: Mein Wunsch, jetzt ein Eis zu essen, eine Gehaltserhöhung zu erhalten, nach Island zu verreisen oder den neusten Film von Woody Allen zu sehen, wird in dem Moment nichtig, in dem ich tot bin. Diese Wünsche geben mir deshalb keinen Grund, am Leben zu bleiben; ich kann diese Wünsche vielmehr mit meinem Tod eliminieren. Bin ich erst mal tot, ist mir Eis schlicht schnuppe. Die Existenz der Wünsche hängt, anders gesagt, von meiner eigenen Existenz ab, und lösche ich Letztere aus, bestehen auch Erstere nicht mehr.
Allerdings trifft diese Abhängigkeit nicht auf alle Wünsche zu: Wir wünschen uns nämlich auch Dinge, die uns durchaus Grund geben, lang und länger zu leben. Viele Menschen wünschen sich zum Beispiel, ihre Kinder und Kindeskinder aufwachsen zu sehen. Oder sie wünschen sich zu erleben, dass sich ihre wissenschaftlichen Thesen bewahrheiten oder ihr Kunstwerk gewürdigt wird. Der britische Philosoph Bernard Williams hat diese Wünsche «kategorisch» genannt: Im Unterschied zu den «bedingten Wünschen», die wir nur haben, insofern wir auch weiterleben (wie Eis essen, nach Island fahren), geben uns kategorische Wünsche auch Grund, weiterleben zu wollen: Wir wollen den Tag noch erleben, an dem unsere Kinder heiraten; wir wollen den Triumph noch einheimsen, dass unsere Theorie die alten Formeln aussticht; wir wollen die Ausstellung unserer Bilder noch eröffnet sehen. Kategorische Wünsche ziehen uns in die Zukunft und drängen zum Weiterleben. Tatsächlich verbinden wir alles, wofür wir brennen, woran uns wirklich liegt, mit kategorischen Wünschen, sagt Williams: Wir möchten, dass diese Dinge ihren Platz in der Zukunft haben, weil sie uns etwas bedeuten unabhängig davon, ob es uns gibt. Insofern liefern uns kategorische Wünsche Grund, am Leben zu bleiben, während die bedingten Wünsche nur bestehen, weil wir am Leben sind.
So bestechend die Idee scheint, ist Bernard Williams’ Schluss, den er aus seiner Unterscheidung von Wünschen zieht, umstritten. Denn er behauptet, dass uns nicht nur die bedingten Wünsche im ewigen Repeat-Modus abhandenkommen, sondern dass uns selbst die kategorischen Wünsche im überlangen Leben ausgehen: Irgendwann sind nämlich unsere Kindeskinder erwachsen, wurde unser Kunstwerk hinreichend gewürdigt, haben unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse Bestand. Irgendwann, sagt Williams, verlieren deshalb die kategorischen Wünsche ihre Strahlkraft. Und wenn wir uns nichts mehr kategorisch wünschen, gibt es in unserem Leben kein Ziel mehr, mit dem wir nicht nur unser Leben füllen können, sondern das wir selber mit Leben füllen wollen, weil dies das Ziel unabhängig von uns wert ist. Anders gesagt, gibt es dann nichts mehr, wofür es sich zu leben lohnt.
Doch hat er recht damit? Kann ich mir nicht neue kategorische Wünsche schaffen? Wenn mein Kunstwerk alle Preise gewonnen hat, kann ich doch umsatteln und mir vornehmen, sämtliche Stadtmarathons dieser Welt zu laufen. Jeden Tag trainiere ich, und jeden Tag spüre ich den Wunsch weiterzuleben, weil ich dieses innige Ziel habe, alle «Finisher»-Medaillen zu holen, die es gibt. «Stimmt», würde Williams wohl sagen – doch wäre ich dann noch ich? Hat meine Identität nicht wesentlich darin bestanden, eine Künstlerin zu sein? Diejenige, die weiterleben will und Marathon läuft, ist dann eine neue Person, so Williams, und deshalb gilt für ihn seine Theorie weiterhin: Dass es für die ursprüngliche Person keinen Grund geben kann, ewig weiterzuleben. Aber vielleicht hat dies nur zur Folge, dass wir neu darüber nachdenken müssen, worin eigentlich die Identität einer Person besteht? Vielleicht gewinnt das Konzept der «multiplen Persönlichkeit» an ganz neuen Dimensionen, wenn wir sehr viel länger leben würden? Existenzen in Serie zum Beispiel?
Der amerikanische Philosoph Samuel Scheffler hat übrigens kürzlich Williams’ Idee aufgenommen: In seinem Buch «Death and the Afterlife» stellt er die Frage, wie wir reagieren würden, wenn wir wüssten, dass wenige Wochen nach dem eigenen natürlichen Tod die Welt unterginge, etwa weil ein Asteroid in die Erde kracht. Scheffler meint, unser Leben würde komplett sinnlos: Nur die Existenz einer Nachwelt – nicht eines Jenseits! –, verleihe unserem Leben Sinn. Denn wenn wir wüssten, dass mit unserem Tod die ganze Welt und alles in ihr Seiende sang- und klanglos verschwände, würden wir aller kategorischen Wünsche beraubt, die eben das ausmachen, woran uns wirklich liegt. Das Weltuntergangsszenario würde letztlich unsere tiefsten Werte zerstören – während dies unser eigener Tod nicht tut. Langlebigkeit oder Unsterblichkeit der Welt ist also existenziell wichtig für uns. Wie persönliche Unsterblichkeit für uns wäre, bleibt erst noch zu erfahren.
Literaturhinweise:
- Bernard Williams (1978): «Die Sache Makropulos: Reflexionen über die Langweile der Unsterblichkeit», in: ders.: Probleme des Selbst, Stuttgart: Reclam.
- Samuel Scheffler (2014): Death and the Afterlife, Oxford: Oxford University Press.
Barbara Bleisch ist Philosophin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Ethik-Zentrum der Universität Zürich. Sie befasst sich mit philosophischen Fragen im Zusammenhang mit der Entwicklung unserer Gesellschaft. Thematische Schwerpunkte ihrer Arbeiten sind Familienethik, globale Gerechtigkeit und das Phänomenen der Doppelmoral. Neben ihrer akademischen Arbeit moderiert sie ausserdem die Diskussionssendung Sternstunde Philosophie im Schweizer Fernsehen SRF.