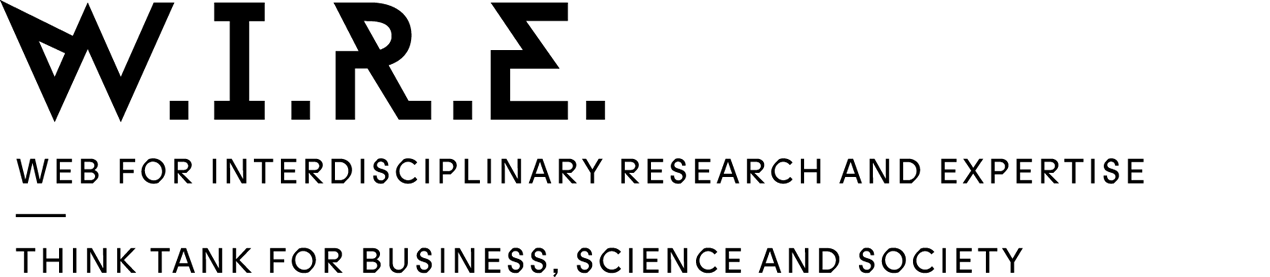Playtime! Gespräch mit Bjarke Ingels
Von Simone Achermann
Unsere Städte scheinen nicht kompatibel mit den Fortbewegungsmöglichkeiten der Zukunft. Dabei sind nur wenige Anpassungen notwendig, um wieder richtig gut in ihnen leben zu können, sagt der dänische Architekt Bjarke Ingels. Ein Start sind Häuser mit einer Strasse direkt aufs Dach und soziale Zwischenräume für Kinder und Angestellte.
Mobilität ist eine der grössten Herausforderungen, vor denen unsere Städte heute stehen. Welche Rolle spielt die Architektur dabei?
Die Architektur erlaubt es uns, Städte so zu bauen, dass wir in ihnen das Leben führen können, das wir führen wollen. Sie verleiht uns die Macht, das Konzept der Evolution Darwins umzukehren: Wir müssen uns nicht mehr nur unserer Umwelt anpassen, unsere (bebaute) Umwelt passt sich uns an. Und die Art und Weise, wie wir unser physisches Umfeld gestalten, hat wiederum grossen Einfluss darauf, wie wir leben – was die Architektur zu einem Schlüsselfaktor der Entwicklung unserer Gesellschaft macht.
Wenn man sich die überfüllten, verkehrsüberlasteten und verschmutzten Städte von heute ansieht, fällt es schwer zu glauben, dass wir Menschen sie mit dem Ziel gebaut haben, ein möglichst gutes Leben zu führen.
Unsere Städte haben sich mit der Zeit entwickelt. Die verschiedenen Fortbewegungsmittel haben in der Geschichte einer Stadt alle ihren eigenen Paradigmenwechsel herbeigeführt: von den engen Gassen in der Altstadt, die nur Fussgängern zugänglich sind, bis hin zu sechsspurigen Autostrassen hatten sie alle einen grossen Einfluss auf die Beschaffenheit des heutigen Stadtbilds. Die urbane Entwicklung in der Nachkriegszeit war allerdings fast ausschliesslich durch das Auto geprägt. Ein Fehler, den wir heute zu korrigieren versuchen mittels eines differenzierteren Verständnisses von urbaner Mobilität und Städteplanung. Langsam bewegen wir uns weg von der Monokultur des Autos, hin zu einer ganzen Palette von Fortbewegungsmöglichkeiten, wobei besonders Fussgängerzonen, Fahrradstreifen und selbstfahrende Autos eine grosse Rolle spielen werden. Kopenhagen ist ein gutes Beispiel für diese Entwicklung. Seit den 1950er-Jahren stieg dort der Anteil an Radfahrern um 50 Prozent. Ein Ampelsystem auf Strassen, das allein für Radfahrer da ist, sorgt dafür, dass das Radfahren sicherer ist als früher – und dabei noch schneller, als wenn man mit dem Auto unterwegs wäre. Viele Berufspendler sind bereits vom Auto auf das Rad umgestiegen. Die Stadt der Zukunft wird also nicht total anders aussehen müssen als die von heute. Aber wenn wir gut leben wollen, müssen wir sie anders nutzen als bisher und uns vor allem anders in ihr fortbewegen.
Der Vorschlag der Bjarke Ingels Group im Rahmen der «Audi Urban Future Initiative» war eine fahrerfreie, keine autofreie Stadt. Sind autonome Fahrzeuge der Schlüssel zum urbanen Mobilitätsproblem?
Man muss die Stadtentwicklung der Nachkriegszeit dafür kritisieren, Autos vor allen anderen Transportmitteln bevorzugt zu haben. Aber das Auto an sich ist nicht schlecht. Es ist ein grossartiges Vehikel, das eine maximale individuelle Freiheit sowie mühelos Zugang zu spärlich besiedelten Gegenden ermöglicht, die mit keinem anderen Transportmittel erreichbar wären. Das Auto ist und bleibt eine wunderbare Erfindung. Aber wenn es die einzige Möglichkeit darstellt, sich fortzubewegen, verursacht es Schaden. Auch kann die Art und Weise, wie wir das Auto nutzen, radikal verbessert werden. Die meiste Zeit stehen Autos entweder auf einem Parkplatz oder im Stau, besetzen also unnötig urbanen Raum. Das selbstfahrende Auto kann uns hier helfen. Wir werden künftig kaum noch Zeit verlieren beim Fahren, weniger oder gar keine Unfälle mehr haben und unsere Wagen mit anderen teilen, wenn wir sie gerade nicht brauchen. Das Faszinierende an Autos ohne Fahrer ist, dass sich mit ihnen die Freiheit des individuellen Transports mit dem nachhaltigen Konzept der Sharing Economy kombinieren lässt.
Viele Ihrer Projekte befassen sich damit, Vorstadt-Gegenden attraktiver zu gestalten. Ist das ein weiterer Lösungsansatz: die Aussenbezirke lebenswerter zu machen?
Ich glaube, die alte Vorstellung von Stadt als Synonym für deren Zentrum macht immer weniger Sinn. Vor fünf Jahren haben wir eine Schwelle überschritten. Mehr als die Hälfte der Menschheit lebt jetzt in Städten. Damit sind aber nicht mehr nur die Zentren, sondern auch die zum Teil riesigen Aussenbezirke gemeint. Heute bezeichnen wir mit Stadt nicht mehr die Champs Elysées oder den Central Park, sondern eine komplexe Dynamik in Bezug auf Bevölkerungsdichte und mobile Erreichbarkeit in einem erweiterten urbanen Umfeld. Immer mehr Menschen leben in einem Stadtteil, arbeiten in einem anderen und schicken ihre Kinder in einem dritten zur Schule. Die lineare Bewegung von den Aussenbezirken ins Stadtzentrum und wieder zurück ist einem multipolaren Verkehr zwischen urbanem und Vorstadt-Bereich gewichen. Diese Entwicklung wird noch weiter voranschreiten und ein Stück weit auch die Verkehrsprobleme entschärfen, indem sie den Weg unmittelbar ins und aus dem Zentrum entlastet.
Werfen wir einen Blick auf die Mobilität innerhalb von Gebäuden: Wie können die verschiedenen Möglichkeiten, sich in Büros zu bewegen, innovatives Denken fördern?
Zuerst einmal ist es entscheidend, Räume so offen wie möglich zu halten. Die Gestaltung eines Arbeitsbereichs sollte spontane Begegnungen mit Kollegen erleichtern, um den Austausch von Ideen zu maximieren. Auch das Gebäude selbst sollte, wenn die Grundsätze des Unternehmens es erlauben, zumindest teilweise für seine Nachbarschaft zugänglich sein. Das ist unser Plan beim Google Campus im Silicon Valley. Das Gebäude ist nicht nur als ein Arbeitsplatz, sondern als kleines Stadtviertel geplant. Diverse freie Grundstücke erlauben Googlern wie Nicht-Googlern, sich im und um den Campus herum zu bewegen. So können Ideen ohne irgendwelche Grenzen hinein- und herausfliessen. Zweitens muss Architektur flexibel sein. Wie bereits erwähnt: Die menschgemachte Umgebung sollte sich uns anpassen, nicht umgekehrt. Der Google Campus besteht aus blockartigen Strukturen, die verschoben werden können und so eine maximale Flexibilität ermöglichen, wenn das Unternehmen in neue Produkt- oder Aktivitätsbereiche vorstösst. Indem wir offene und flexible Gebäude entwerfen, die sich mit der Zeit an die Bedürfnisse anpassen und ihren Zweck verändern können, imitieren wir die Art und Weise, wie die Natur funktioniert. Auch in der Natur ist alles in stetigem Wandel begriffen, nichts ist unveränderbar. Denn das wäre ihr Todesurteil.
Die Art und Weise, wie wir uns in Städten bewegen, beeinflusst auch die Interaktion mit unseren «Mitbewohnern». Wie können wir durch Mobilitätskonzepte den sozialen Dialog fördern?
Ein wichtiger Faktor ist der Raum für Nischen in und um die Arbeits- und Wohnräume herum. Die sogenannten Zwischen-Räume, die weder ausschliesslich öffentlich noch privat sind, spielen dabei eine grosse Rolle. Ein Beispiel hierfür ist das «8 House» in einem relativ neuen Aussenbezirk Kopenhagens. Für dieses Gebäude haben wir einen Weg gebaut, der direkt von der Strasse aufs Dach führt. Das ermöglicht seinen Bewohnern, von ihrer Wohnung aus zu Fuss oder mit dem Fahrrad zu Freunden oder Nachbarn zu kommen – sei es im Gebäude selbst oder ausserhalb. Ein kleines Mädchen im neunten Stock zum Beispiel kann gleich auf ihr Rad springen, wenn es einen Nachbarjungen auf der Strasse oder eine Freundin auf einem anderen Stockwerk spielen sieht – und diese im Nu erreichen, ohne einen Lift benutzen zu müssen. Ein anderes Beispiel für Zwischen-Räume sind die sogenannten «courtscrapers». Ein «courtscraper» ist eine Mischung aus «skyscraper» und «courtyard building», also Wolkenkratzer und Gebäude mit Innenhof. Es sind Hochhäuser mit einem weitläufigen Innenhof, der als öffentlicher Raum für mehrere Hundert Wohnungen dient. Es ist ein Ort, an dem Nachbarn sich treffen, Kinder spielen und ihre Spielsachen über Nacht herumliegen lassen können, um sie am nächsten Morgen am exakt selben Ort wiederzufinden. Solche Zwischen-Räume sind für die Erhöhung sozialer Begegnungen in Nachbarschaften zentral.
Eine gute städtische Infrastruktur reicht aber nicht aus. Die Bewohner müssen ihre Stadt auch besser «benutzen», damit Wandel wirklich möglich wird.
Absolut. Wir Menschen haben sogar auf die Beschaffenheit unseres Planeten massiven Einfluss ausüben können, wie wir alle wissen. Aber aus grosser Macht folgt grosse Verantwortung, um Spider-Man zu zitieren. Mit dem Zweiten tun wir uns immer noch schwer. Ich bin jedoch überzeugt, dass sich Nachhaltigkeit und Hedonismus nicht ausschliessen müssen. Es ist möglich, nachhaltig zu leben und gerade dadurch die Lebensqualität oder den Genuss zu erhöhen. Das Ziel vieler unserer Projekte ist es, aufzuzeigen, wie das funktionieren könnte: mit einer Skipiste über einer Müllverbrennungsanlage zum Beispiel, einem Fabrikschornstein, der Rauchringe bildet, um die Menschen in origineller Weise auf die Luftverschmutzung hinzuweisen, oder mit dem «8 House», das seine Bewohner dazu ermutigt, mit dem Fahrrad direkt von der Wohnung zur Arbeit zu fahren. Wenn wir wollen, dass ein nachhaltiges Leben funktioniert, darf es keine Bestrafung sein. Es muss Spass machen.
Bjarke Ingels ist ein dänischer Architekt. Er ist Gründer und Mitinhaber des Architekturbüros BIG mit Sitz in Kopenhagen und New York. Ingels preisgekrönte Bauten zeichnen sich durch einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und Verspieltheit in den Nutzungsmöglichkeiten aus: Sie sind Wohnraum, Erlebnis und Symbolträger zugleich. Für den Urban Future Award von Audi entwickelte Ingels das Konzept der «Driverless city», eine Stadt der Zukunft, die nicht ohne Autos sondern ohne Fahrer auskommt. Zurzeit arbeitet Ingels mit BIG am neuen Google Campus in Silicon Valley, das sowohl als Büro für Googler als auch als Nachbarschaft für Non-Googler konzipiert ist.