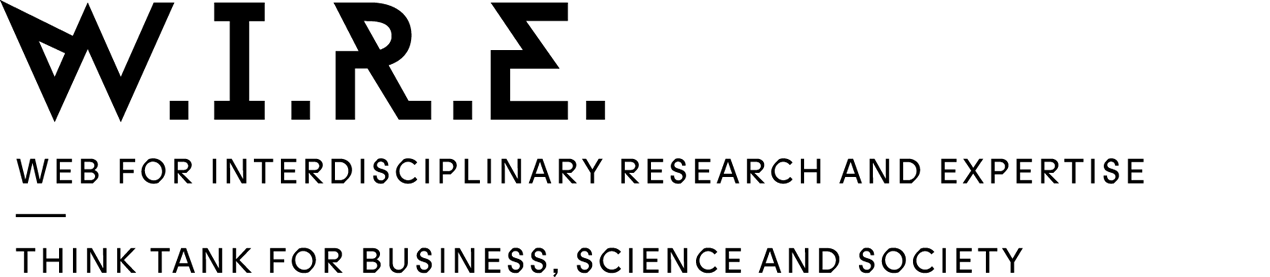Was bleibt, ist die Kunst. Interview mit Hans Ulrich Obrist
Simone Achermann und Stephan Sigrist
Kunst kann beides: Sie bewahrt die Schätze vergangener Kulturen und liefert die Basis für die Entstehung von Neuem, sagt Hans Ulrich Obrist. Der Kurator der Serpentine Gallery in London spricht über die Ursachen des Kunsthypes, darüber, was ein Werk zum Klassiker macht, und über die Folgen der Digitalisierung – mit der wir alle zu Sammlern und Kuratoren wurden.
Täglich strömen weltweit Millionen von Menschen in Museen mit Kunst aus vergangenen Zeiten. Warum?
Dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen sind Museen Zeitboxen, in denen wir die Vergangenheit erleben können – etwas, was die Menschen immer faszinieren wird. Zum andern sind sie Werkzeugkisten für die Zukunft. Wie der Kunsthistoriker Erwin Panofsky gesagt hat: «Die Welt von morgen wird aus den Fragmenten der Vergangenheit gemacht. » Museen sind also gewissermassen vergleichbar mit dem menschlichen Gehirn: Sie sind sowohl Archive der Vergangenheit als auch Ausgangspunkt für dynamische Prozesse, aus denen Neues entsteht.
Was macht ein Kunstwerk zeitlos?
Ein Aspekt ist sicherlich die Fähigkeit, in anderen Kulturen und Zeiten relevant zu bleiben. Wenn Kunst keine Bedeu tung für die Zukunft hat, ist sie statisch und geht vergessen. Doch meistens ist Kunst so mehrdeutig, dass selbst historische Bilder, die sich einem spezifischen Ereignis in der Geschichte widmen, in einem andern Kontext wieder wichtig werden. Goya zum Beispiel ist heute höchst aktuell, wenn man an die jüngsten Befreiungskriege in Nordafrika denkt. Das andere Kriterium, das Kunst zeitlos macht, ist die Tatsache, dass wir sie immer wieder «besichtigen» und dabei Neues entdecken können. Jedes Mal, wenn ich einen Film von Godard sehe oder ein Bild von Richter betrachte, entdecke ich wieder ein überraschendes Detail.
Der Trend hin zu Pop-up-Galerien und Installationskunst zeigt: Das Flüchtige hat einen hohen Stellenwert in der zeitgenössischen Kunst. Wie wichtig ist Beständigkeit denn noch?
Der Moment, in dem wir Kunst erleben, wird immer wichtiger. Allerdings bedeutet dies nicht, dass dieser zwingend kurz sein muss. Im Gegenteil, viele Künstler machen ihn absichtlich lang. Ein gutes Beispiel ist 24 Hour Psycho von Douglas Gordon (1993), ein Film, den ich als Student sah. Gordon zieht Hitchcocks Klassiker in 24 Stunden Länge. Ein ähnliches Konzept liegt meinem Projekt The Interview zugrunde, in dem ich Tausende von Stunden Momentaufnahmen mit Künstlern, Architekten, Schriftstellern und Wissenschaftlern gesammelt habe. Es ist die Kombination einer limitierten Zeitdauer mit einer gewissen Kontinuität, die spannend ist. Ich würde also sagen, beides ist heute relevant: Flüchtigkeit und Beständigkeit.
Nie zuvor wurde so viel Kunst gesammelt wie heute. Ist dies eine Reaktion auf die digitalisierte Welt?
Ja, es ist sicher eine Reaktion auf das Immaterielle. Gründe sind aber auch der steigende Wohlstand der Gesellschaft sowie dessen Instabilität. Weil die Leute reicher sind, können sie mehr Kunst kaufen. Gleichzeitig führen die Unsicherheit an den Aktienmärkten und die Währungskrise dazu, dass mehr «sichere» Investitionen getätigt werden. Aber vor allem lieben immer mehr Menschen Kunst. Die Kunst ist im 21. Jahrhundert der Ort, an dem jeder sein will. Dies vor allem deshalb, weil sie verschiedene Welten vereint. Ausstellungen sind so frei in ihrem Format, dass sie Menschen aus allen Bereichen zusammenführen können. Ich persönlich liebe Kunst, Literatur, Film, Tanz, Wissenschaft und studiert habe ich Wirtschaft. In der Kunst kann ich all diese Interessen vereinen. Wenn Joseph Beuys in den Sechzigerjahren gesagt hat, «Jeder ist ein Künstler», so sage ich heute, jeder ist ein Kurator. Als ich in den Siebzigerjahren in der Schweiz aufwuchs, kannte man diesen Beruf nicht. Meine Eltern dachten, Kurator sei eine Art Arzt. Heute wird alles kuratiert: die Ted-Konferenz, die Bücherlisten von Amazon, Blogs – und die eigene Bildersammlung auf dem Computer.
Anders als die meisten Konsumgüter behalten Kunstwerke ihren Wert langfristig oder steigern ihn gar. Kann die Wirtschaft von der Kunst lernen?
Gewiss. Jedes Unternehmen und jede Regierung einer grösseren Stadt sollte einen Künstler im Beratungsboard haben. Es ist das Konzept der Artist Placement Group. 1966 von John Latham und Barbara Stevins als Künstlerorganisation gegründet, hatte die APG das Ziel, Kunst auf Bereiche ausserhalb der Galerien auszudehnen, hauptsächlich dadurch, dass ein Künstler in einem Unternehmen oder einem politischen Umfeld für einen fixen Zeitrahmen eingesetzt wurde. Das Konzept ist heute besonders attraktiv, in einer Zeit, in der Kunst über die gesamte Gesellschaft hinweg populär geworden ist.
Nennen Sie drei Dinge, die bleiben werden, und drei Dinge, die es in Zukunft nicht mehr geben wird.
Was sicher bleibt, ist die Kunst. Ich glaube an die Kunst, weil sie der Kristallisationspunkt einer jeden Kultur ist, das, woran wir den wahren Charakter einer Gesellschaft erkennen. Auch ist Kunst die höchste Form von Hoffnung. Solange es Hoffnung gibt, gibt es auch Kunst. Die weiteren zwei Dinge, die ebenfalls bleiben werden, sind die Architektur und die Literatur, weil sie genauso repräsentativ für eine bestimmte Zeit sind. Was es vielleicht nicht mehr geben wird, ist die Vielfalt – zum einen der Kulturen und Sprachen als Folge der Globalisierung, zum andern der Tier und Pflanzenwelt als Folge der ökologischen Krise. Auch wird es Verkehrsmittel, wie wir sie heute kennen, bald nicht mehr geben. Zum Beispiel werden herkömmliche Flugzeuge durch solarbetriebene ersetzt werden. Das dritte, das es in Zukunft nicht mehr geben wird – uns wird es nicht mehr geben, uns drei.
Was stimmt Sie nostalgisch?
Ich kenne die Nostalgie nicht wirklich. Doch ich protestiere gegen das Vergessen. Das Projekt The Interview steht mit seinen Tausenden von Stunden aufgezeichneter Gespräche dafür. Allerdings gibt es doch etwas, was ich vermisse: Briefe. Mein Archiv mit den Briefen von Künstlern, die mir in den Siebzigerjahren geschrieben haben, wird demnächst veröffentlicht. Wir sollten aber der Vergangenheit nicht nachtrauern, sondern versuchen, etwas Neues aus ihr zu machen. Zum Beispiel, indem wir Briefe in die Gegenwart zurückholen. Ein grosser Teil meiner Korrespondenz ist handschriftlich und ich habe angefangen, gescannte Briefe per Mail zu versenden, so dass der Empfänger statt eines Mails einen Brief ausdrucken kann. Das ist doch eine gute Art, wie man moderne Technologie mit der Schönheit alter Medien kombinieren kann.
Hans Ulrich Obrist ist Kodirektor der Serpentine Gallery in London. Zuvor war er Kurator des Musée d’Art Moderne in Paris sowie des Museum in Progress in Wien. Obrist hat über 250 Ausstellungen kuratiert, die erste davon The Kitchen show (World Soup, 1991). Es folgten unter anderem die 1. Berlin- Biennale (1998), die 1. und 2. Moskau-Biennale (2005/ 2007) sowie Indian Highway (2008–2011). Nebst seiner Arbeit als Kurator hat Obrist diverse Bücher herausgegeben, so die Schriften von Gerhard Richter, Louise Bourgeois sowie Gilbert & George. Auch hat er bei über 200 Buchprojekten mitgewirkt. Zu seinen jüngsten Veröffentlichungen gehören «A Brief History of Curating», The Conversation Series (Vol. 1–20.) sowie «Ai Weiwei Speaks». Im März 2011 wurde Hans Ulrich Obrist vom Bard College der Award für kuratorische Exzellenz verliehen.