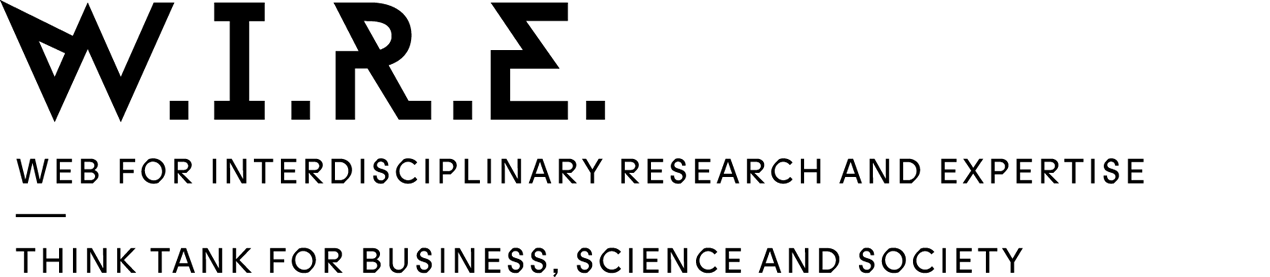Solidarität mit den Jungen! Gespräch mit Pascal Couchepin
Von Simone Achermann
Ohne ein Gefühl der Zusammengehörigkeit besteht keine Gesellschaft auf Dauer. Denn nur wer an das gemeinsame Ziel glaubt, kann sich weiterentwickeln. Dennoch: Die bestehenden Gesellschaftsverträge müssen neu definiert werden. So sollten sich in Zukunft nicht nur Junge mit alten Menschen solidarisch zeigen, sondern auch umgekehrt, sagt der ehemalige Schweizer Bundesrat Pascal Couchepin.
Solidarität ist ein Schlagwort. Welche gesellschaftliche Rolle hat sie heute tatsächlich noch?
Keine geringere als früher. Denn ohne ein gewisses Mass an Solidarität hat unsere Gesellschaft keine Zukunft. Die Einstellung der Menschen ist entscheidend für den Erfolg eines jeden Projekts, ob das die Gründung eines Unternehmens ist oder die Wahrung des Wohlstands einer Nation. Und dazu braucht es das Gefühl, dass man zusammengehört und dasselbe Ziel verfolgt. Wenn dieses fehlt, ist Fortschritt nicht möglich. Nehmen wir die EU als Beispiel: In der Realit.t besteht keine Gefahr, dass Europa an der Krise zerbricht. Weil die EU-Bürger aber zu wenig an das gemeinsame Ziel glauben, beherrscht die Angst die Köpfe der Leute. Dies hat eine lähmende Wirkung auf die Entwicklung Europas.
Was kann dagegen getan werden?
Die Politiker müssen transparenter kommunizieren. Ein Grund für das fehlende Vertrauen in die EU liegt darin, dass den Leuten viel zu viel versprochen wurde und sie entsprechend enttäuscht sind. Man hätte von Anfang an klarstellen müssen, dass es Probleme geben wird und dass einige Staaten dafür bezahlen werden. Die Regierungen der nördlichen EU-Nationen wurden nicht überrascht von der Verschuldung des Südens. Das wussten alle, nur hat man es fälschlicherweise dem Volk verschwiegen. Abgesehen von der Krise und dem noch unausgereiften europäischen Identitätsgefühl ist die EU aber eigentlich ein Produkt grosser Solidarität. Ihr Hauptziel ist die Wahrung des Friedens. Und nie zuvor in der Geschichte Europas lebten die Nationen so lange friedlich miteinander. Das ist ein unglaublicher Erfolg.
Genau dieses Ziel geht aber in Anbetracht der Eurokrise zunehmend vergessen.
Zwar wird die Wahrung des Friedens nicht genügend in den Vordergrund gerückt, aber sie ist unangefochten. Man muss bedenken, dass die EU noch sehr jung ist. Sie erlebt gegenwärtig die erste Krise und wird eine nächste bereits ohne grossen Identitätsverlust überleben. Wahrscheinlich gilt das sogar für die aktuelle. Die Leute sind empört, die einen über die geforderten Sparmassnahmen, die andern über die Höhe der Hilfsleistungen an die verschuldeten Staaten. Gleichzeitig aber zeigen die Wahlergebnisse in Griechenland, dass selbst bei sehr angeheizter Stimmung die Moderaten gewinnen. Das bedeutet: Die Menschen sind zwar wütend, wissen aber dennoch, dass ohne Kompromisse zu viel auf dem Spiel steht.
Und wie steht es um das Zusammengehörigkeitsgefühl auf nationaler Ebene?
Nehmen wir die Schweiz als Beispiel. Wir sind ein äusserst solidarisches Land. Doch unsere Solidarität leidet stark darunter, dass die Leute glauben, diese werde missbraucht. Das erste Ziel muss es also sein, Missbräuche zu verhindern. Bei der Invalidenrente wurde das vorbildlich umgesetzt: Es wird heute viel strenger kontrolliert, wer eine Rente erhält. Als Folge hat die absolute Zahl der IV-Rentner abgenommen – und die Solidarität mit ihnen zugenommen. Generell kann man sagen: Das Niveau der Solidarität hängt massgeblich mit der Kontrolle des Sozialsystems zusammen. Ist zu viel Missbrauch möglich, sind die Leute nicht mehr bereit, für das System einzustehen. Dies gilt auch für die Solidarität mit alten Menschen. Die Armut im Alter gilt in der Schweiz praktisch als bekämpft. Trotzdem will man immer mehr Zusatzleistungen anbieten. Das macht keinen Sinn. Eine Alternative ist: Man muss sich dafür bewerben und nur wer wirklich belegen kann, dass das Budget nicht reicht, soll weitere Leistungen erhalten. Bei diesem Modell würden zwar auch Solidarleistungen gesprochen, doch nicht mehr an alle, sondern nur an diejenigen, die sie .verdienen.. Dies verlangt auf Seiten der Empfänger mehr Eigenverantwortung und sorgt gleichzeitig für mehr Verständnis und Unterstützung auf Seiten der Steuerzahler.
Bleiben wir bei der Solidarität zwischen Alt und Jung: Ist der Generationenvertrag überhaupt noch tragbar bei der zunehmenden Überalterung?
Durch die demografische Verschiebung wird er sogar noch viel wichtiger. Doch die Umverteilung der Gelder zwischen Alt und Jung bedarf dringend einer Umstrukturierung, die den ver$nderten Verhältnissen gerecht wird. Die erste und einfachste Massnahme ist es, die Zahl der Alten durch die Erhöhung des Pensionsalters zu reduzieren. Dieser Vorschlag stösst zwar auf hartnäckigen Widerstand, aber nur, weil man ihn nicht einfach genug erklärt, zum Beispiel so: .Sie haben 100 000 Franken zur Verfügung. Nun können Sie die Summe entweder auf 17 Jahre oder auf 22 Jahre verteilt erhalten. Bei der ersten Variante müssen Sie lönger arbeiten, erhalten dafür mehr monatliche Rente, bei der zweiten gehen Sie früher in Pension, beziehen aber jeden Monat weniger Rente. Das leuchtet doch jedem ein. Ein zweiter Ansatz ist es, nicht nur die Solidarität der Jungen mit den Alten zu stärken, sondern auch umgekehrt. Dies kann durch eine Neustrukturierung der Umverteilung erfolgen: Nicht mehr nur die Jungen müssten den Alten von ihrem Lohn abgeben, sondern auch die Alten den Jungen einen kleinen Anteil ihrer Pension.
Nur, wie kann man Massnahmen zugunsten der Jungen bei den immer älteren Stimmbürgern durchsetzen?
Das Problem liegt auch bei den jungen Wählern. Den Schweizer Abstimmungsvorschlag 2010 zur Anpassung des Umwandlungssatzes, der die Rente in kleineren Rationen, aber dafür über mehrere Jahre verteilt ausbezahlen wollte, um der längeren Lebensdauer der Bevölkerungen gerecht zu werden, haben 71 Prozent der Bevölkerung ab- gelehnt. Das war nicht nur der Entscheid der älteren Stimmbürger. Der Grund dafür lag darin, dass die Leute die Idee nur ungenügend verstanden haben. Es ist die Aufgabe des Bunds, einfache Erklärungen zu finden und Transparenz zu schaffen. Das wird viel zu wenig gemacht. Das Beispiel mit den 100 000 Franken ist sehr anschaulich; ich habe es aber noch nie einen Politiker erwähnen hören.
Kommen wir von Alt –Jung zu Arm – Reich: Wie destabilisierend wirkt sich die Schere zwischen den Einkommen auf die Gesellschaft aus?
Auf die Schweiz hat dies keine grosse Auswirkung, weil es bei uns kein sehr grosses Lohngefälle gibt – abgesehen von den wenigen Lohnexzessen, die das eigentlich gut funktionierende System kaputtmachen. Diese verzerren die Zahlen und machen in der Wahrnehmung der Bevölkerung aus einer eigentlich kleinen Einkommensschere eine grosse, was das Volk unnötig verärgert. Allerdings sind viele der Leute, die unproportional viel verdient haben, aufgrund der Finanzkrise mittlerweile entlassen worden. Auch generell ist man zur Einsicht gekommen, dass so hohe Löhne nicht bezahlt werden müssen, um gute Arbeitskräfte zu gewinnen. Das war keine natürliche Marktentwicklung, wie oft behauptet, sondern eine Beschlagnahmung des Reichtums durch eine kleine Gruppe von Leuten. Ich glaube nicht, dass dies so bald wieder möglich sein wird. Die Krise hat unsere Gesellschaft wohl doch etwas vernünftiger gemacht und das ist gut so.
Was ist die Rolle der Wirtschaft bei der Wahrung der Solidarität von morgen?
Die Wirtschaft hat überall auf der Welt die gleiche Aufgabe: den Profit zu sichern. Dafür sind stabile Verhältnisse entscheidend, sprich solide soziale Verhältnisse und gute Ausbildungsmöglichkeiten. Das kann die Wirtschaft nicht ignorieren. In der Schweiz nimmt sie ihre Rolle vorbildlich wahr. Dafür stehen die Pensionskasse, gute Lehrlingsausbildungen und eine gewisse Zurückhaltung gegenüber Massenentlassungen.
Was halten Sie vom «Big Society»-Programm des britischen Premiers Cameron: Müssen wir angesichts der Krise alle wieder vermehrt auf Nachbarschaftshilfe setzen?
Ich habe eine gewisse Sympathie für diese Haltung. Solidarität ist nicht nur Aufgabe des Staats, sondern auch der Bevölkerung. Und sie sollte sich nicht nur materiell, sondern auch in Taten, zum Beispiel konkreter Nachbarschaftshilfe, manifestieren. Ein Beispiel, wie Solidarität zwischen Bürgern anders geregelt werden kann, zeigt ein Versuchsprogramm des Kantons St. Gallen. Das Ziel des Projekts ist es, eine Art Sparbank für Freiwilligenleistungen aufzubauen. Menschen, die Freiwilligenarbeit leisten, sollen ein Konto erhalten, auf dem sie die Stunden, die sie für die Gemeinschaft investiert haben, verbuchen können. Werden sie selbst einmal bedürftig, bekommen sie diese Zeit gutgeschrieben. Das ist ein sehr sinnvolles Prinzip. Es w.re gut, wenn beispielsweise das Schweizerische Rote Kreuz, dessen Aufgabe die Wahrung der Solidarität ist, ein ähnliches Projekt schweizweit durchführen würde. Allerdings kann der Staat nur einen gewissen Teil der Verantwortung an die Bevölkerung abgeben. Die .Grosse Gesellschaft. hat keinen Erfolg gehabt in England, weil sie von den Leuten nur als Vorwand für die Abgabe staatlicher Verantwortung zwecks massiver Sparmassnahmen verstanden wurde. Aber auch, weil England eine andere Solidaritätskultur hat.
Wie unterscheidet sich diese denn von der unsrigen?
Der französische Autor Emmanuel Todd kategorisiert verschiedene Gesellschaftstypen nach ihren unterschiedlichen Erbgesetzen. Seine Begründung: Das Erbsystem eines Lands oder einer Region pr.gt die Erwartungshaltung der Bürger an den Staat und seine Mitbürger – und somit auch die Solidaritätskultur eines Lands, wenn wir den Gedanken noch etwas weitertreiben. In der Schweiz erwarten alle, etwas von ihren Eltern zu erben, auch wenn dies noch so wenig ist. Nehmen wir das Erben eines Bauernhofs als Beispiel: Im schweizerischen Wallis wird das Besitztum in exakt gleichen Teilen an die Erben verteilt, das heisst, der Hof wie auch der Boden wird entsprechend zerstückelt. Erhält ein Familienmitglied nicht genau gleich viel, bedeutet dies das Ende der Bruderschaft. In anderen Regionen der Schweiz erhält zwar nur der älteste oder der jüngste Sohn den Bauernhof, die anderen haben aber Anspruch auf den Rest des Besitzes. In England jedoch kann der Vater sein Vermögen vermachen, wem er will, ob einem Mitglied der Familie oder nicht, ohne dass es dadurch zwingend zu Auseinandersetzungen kommt. Meine englische Professorin erzählte mir von ihrem reichen Grossvater, der sein ganzes Vermögen einem Vetter vererbt hat. Ich war empört. Sie aber war dankbar, eine gute Erziehung und Ausbildung genossen zu haben und hatte nicht die Erwartung, darüber hinaus noch Geld oder Boden zu erben. Das Erbgesetz pr.gt die Haltung der Engländer: Die Ungleichheit ist zwar viel grösser als in der Schweiz, aber akzeptierter, weil man weiss, dass jeder selbst für sein Schicksal verantwortlich ist. Dies bedeutet aber auch, dass in der englischen Gesellschaft wenig Platz für Nachbarschaftshilfe, für eine .Big Society. ist.
Und welche Solidarsysteme taugen auch in Zukunft?
Man kann keine allgemeingültige Solidaritätstheorie aufstellen. In jedem Land gibt es eine andere Haltung zur Solidarität. Doch es ist wichtig, dass alle anerkennen, dass es eine gewisse Solidarität braucht.
Pascal Couchepin ist ehemaliger Schweizer Bundesrat. Während seiner Amtszeit von 1998 bis 2009 stand er dem Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement und dem Eidgenössischen Departement des Innern vor. In den Jahren 2003 und 2008 war er Bundespräsident der Schweiz. Vor seiner Wahl in den Bundesrat war Couchepin Mitglied mehrerer Verwaltungsräte sowie Präsident der Schweizerischen Multiple Sklerose Gesellschaft. Auch war er in verschiedenen Behindertenorganisationen aktiv. Pascal Couchepin ist studierter Rechtswissenschaftler und Anwalt.